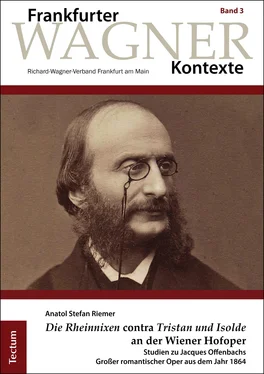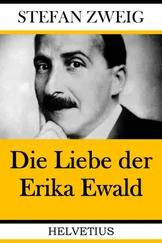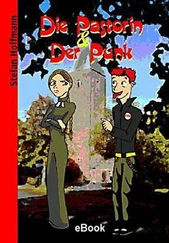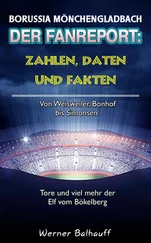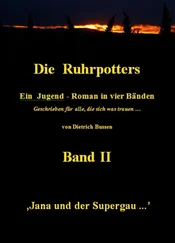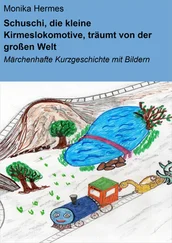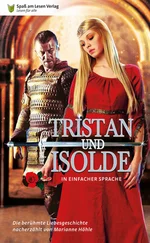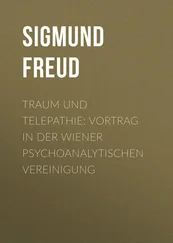2.) In »Eine Kapitulation« nimmt Wagner 1871 eine Zuspitzung auf einen einzigen Begriff vor und bezeichnet Offenbach als das »internationalste Individuum der Welt« 53und fährt hämisch fort: »Wer ihn in seinen Mauern hat, ist ewig unbesieglich und hat die ganze Welt zum Freund! – Erkennt ihr ihn, den Wundermann, den Orpheus aus der Unterwelt, den ehrwürdigen Rattenfänger von Hameln?« In diesem sarkastischen »Lustspiel in antiker Manier«, nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 ursächlich für die jahrelange Verbannung seiner Werke von den Spielplänen der französischen Opernhäuser, 54revanchiert sich Wagner für die Verunglimpfung seiner Person in der Symphonie de l’avenir und spielt mit Versen wie »Oh, wie süß und angenehm, / und dabei für die Füße so recht bequem!« erneut auf den tänzerisch-schlüpfrigen Gestus von Offenbachs Musik an, bei dessen Trompetenspiel sich die Pariser Kanalratten schließlich »in Damen vom Ballett im leichtesten Opernkostüme« verwandeln.
3.) Und schließlich versteigt sich Wagner, ebenfalls 1871, in den »Erinnerungen an Auber« mit Blick auf die vermeintlich seichte und niveaulose, international zusammengeklaubte Kunst seines deutsch-französischen Rivalen zu folgendem Bild:
»Auber sollte seine ganze künstlerische Mühe für vergeblich halten, als er auf jenem so zierlich verdeckten Schmutze jetzt Jacques Offenbach sich behaglich herumwälzen sah. ›Fi donc!‹ mochte er sich sagen; bis die deutschen Hoftheater kamen, und sich das Ding für ihr Behagen zurecht machten. Da ist denn nun allerdings Wärme; die Wärme des Düngerhaufens: auf ihm konnten sich alle Schweine Europa’s wälzen.« 55
Ein Zeugnis der eher beiläufigen Beschäftigung Jacques Offenbachs mit Richard Wagner stellt das im Anschluss an seinen Amerika-Aufenthalt veröffentlichte Reisetagebuch »Offenbach en Amérique« aus dem Jahr 1877 dar. Über eine musikalisch völlig unbefriedigende Aufführung von Giacomo Meyerbeers Opéra comique L’Étoile du nord (1854) im Booth’s Theater in New York stellt Offenbach – gleichsam in Umkehrung von Hans von Bülows Bonmot »Rienzi ist Meyerbeers beste Oper« 56– beispielweise amüsiert fest:
»L’opéra de Meyerbeer n’ayant pas été suffisamment répété, manquait absolument d’ensemble dans le finale du second acte surtout. Les chœurs et l’orchestre couraient les uns après les autres. Course inutile. Ils n’ont jamais pu se rejoindre. On croyait assister à une œuvre médiocre de Wagner.« 57
Und der Besuch eines New Yorker Konzertes mit unsichtbarem Orchester verrät – auch wenn das Ergebnis Offenbach im konkreten Fall keineswegs überzeugt – immerhin seine interessierte Beobachtung von Wagners aufführungspraktischen Neuerungen im Bayreuther Festspielhaus:
»C’est au Lyceum Theater que pour la première fois on mit l’orchestre hors de la vue du public, tentative que Wagner renouvelle en ce moment à Bayreuth. On a bien vite trouvé les inconvénients de cette innovation. D’abord l’acoustique était très-mauvaise; puis les musiciens, entassés dans un bas-fond et ayant trop chaud, se rafraîchissaient comme ils pouvaient.« 58
Jacques Offenbachs letzte und zugleich umfangreichste schriftliche Auseinandersetzung mit Richard Wagner findet sich in seinem Beitrag für das einmalig zugunsten der Opfer der Überschwemmungen in der Region Murcia im Dezember 1879 erschienene Journal »Paris – Murcie«. In dieser späten Schrift hinterfragt Offenbach u. a. die bleibenden, substantiellen Errungenschaften von Wagners Musikdrama und stellt diesbezüglich fest:
»[Unsere jungen Meister] sind von diesem Medusenkopf paralysiert, der ihnen als Zielpunkt dient: dem von Richard Wagner. Sie halten diese mächtige Persönlichkeit für das Haupt einer musikalischen Denkschule. Die Verfahrensarten, die mit ihm geboren wurden, werden mit ihm sterben. Er rührt von niemandem her; niemand wird von ihm leben. Ein wunderbares Beispiel der Entstehung aus dem Nichts: Auf dem Parnassus trägt Richard Wagner in den Zivilstand ein: ›Vater und Mutter unbekannt‹, er wird auch keine Nachkommenschaft aufweisen. Hier scheint eine nördliche Morgenröte, die man für die Sonne gehalten hat. […] Wagner und seine Adepten vertreten, so sagt man uns, die ›Zukunftsmusik‹. Welche Dauer geben sie dieser Zukunft? Jetzt ist es bald fünfunddreißig Jahre her, dass Tannhäuser und Lohengrin ihren rechtmäßigen Erfolg gehabt haben. Wo ist ihre Nachkommenschaft? Was haben sie erzeugt? Wäre Wagner das Haupt einer Denkschule, dann würde seine Schule in voller Blüte stehen.« 59
Zwei der späten Äußerungen Richard Wagners über Jacques Offenbach schließlich beziehen sich auf Orphée aux Enfers (1858) bzw. auf die posthum uraufgeführten Les Contes d’Hoffmann (1881) und damit auf die Eckpfeiler von dessen erfolgreichem Bühnenschaffen. Im vierten Teil von »Mein Leben« erinnert sich Wagner an seine Begegnungen mit dem Mainzer Kapellmeister Wendelin Weißheimer im Frühjahr 1862 und diktiert Cosima Wagner um 1880:
»Dies führte mich auch auf Ausflüge nach jener Gegend hin, während ich des jungen Weißheimers Talent als Orchesterdirigent durch eine Aufführung von Offenbachs ›Orpheus‹, bis wohin er einzig in einer untergeordneten Stellung am Theater zu Mainz gelangt war, kennenlernte. Ich war wahrhaft entsetzt, durch die Teilnahme an dem jungen Mann mich bis zur Assistenz einer solchen Scheußlichkeit herabgebracht zu sehen, und konnte lange Zeit nicht anders, als Weißheimer meinen Mißmut hierüber auffällig nachzutragen.« 60
Und angesprochen auf eine der größten Katastrophen der Theatergeschichte, den Brand des Wiener Ringtheaters am 8. Dezember 1881, in dem gerade die zweite Vorstellung von Les Contes d’Hoffmann beginnen sollte, 61bemerkt Richard Wagner gegenüber Carl Friedrich Glasenapp:
»Es klingt hart und geht fast über die Natur hinaus: aber die Menschen sind zu schlecht, als daß es einem besonders nahegehen könnte, wenn sie in Massen untergehen. Was in einem solchen Theater beisammensitzt, ist das nichtsnutzigste Volk. Wenn in einer Kohlengrube Arbeiter verschüttet werden, da ergreift und empört es mich, da kommt mir das Entsetzen an über eine Gesellschaft, die sich auf solchem Wege Heizung verschafft. Wenn aber so und soviele aus dieser Gesellschaft umkommen, während sie einer Offenbachschen Operette beiwohnen, worin sich auch nicht ein einziger Zug von moralischer Größe zeigt, – das läßt mich gleichgültig, das berührt mich kaum.« 62
Die letzte, in der Offenbach-Literatur häufig zitierte Äußerung Richard Wagners über seinen Komponistenkollegen findet sich schließlich in einem Brief an Felix Mottl vom 1. Mai 1882. Sie schlägt noch einmal einen versöhnlicheren Ton an und nimmt dabei die Schreibweise Offenbachs, den Ton seiner Musiksprache insgesamt in den Blick:
»Oh, mein lieber Freund, ich habe dieses Menuett heute morgen gespielt, und ich bin hellauf begeistert. Betrachten Sie Offenbach. Er versteht es ebensogut wie der göttliche Mozart. Mein Freund, das ist eben das Geheimnis der Franzosen. Ich bin ihnen in vielen Dingen nicht wohlgesonnen. Aber dennoch muß man diese in die Augen springende Wahrheit zugeben: Offenbach hätte ein zweiter Mozart werden können.« 63
1.3 Die Rheinnixen contra Tristan und Isolde
Im »Epilogischen Bericht« von 1871 findet sich jene Textpassage, in der Richard Wagner auf die »Verhinderung« der Uraufführung von Tristan und Isolde an der Wiener Hofoper und die Bevorzugung von Jacques Offenbachs Die Rheinnixen zu sprechen kommt:
»Es würde nicht in den Rahmen dieses vorliegenden Berichtes passen, wollte ich die […] Umstände und Einflüsse besprechen, welche dort die bereits zu den hoffnungsvollsten Ergebnissen geleiteten Vorbereitungen zu einer ersten Aufführung von ›Tristan und Isolde‹ schließlich unnütz machten und die Erscheinung meines Werkes verhinderten. […] Als ich der Direktion mich endlich dazu erbot, mit besonderer Berücksichtigung der Kräfte und des Personalbestandes des Theaters ein neues Werk eigens für Wien zu schreiben, ward mir der wohlerwogene, schriftliche Bescheid zugetheilt, daß man für jetzt den Namen ›Wagner‹ genügend berücksichtigt zu haben glaube, und es für gut finde, auch einen anderen Tonsetzer zu Worte kommen zu lassen. Dieser andere war Jacques Offenbach, bei dem wirklich ein besonderes für Wien zu schreibendes, neues Werk gleichzeitig bestellt wurde.« 64
Читать дальше