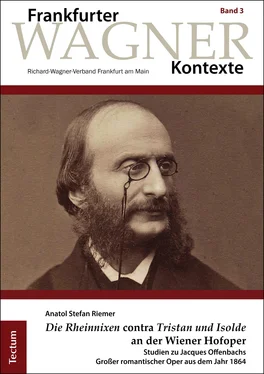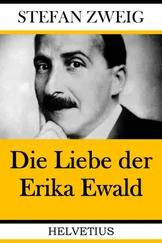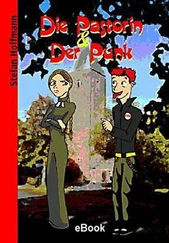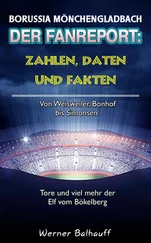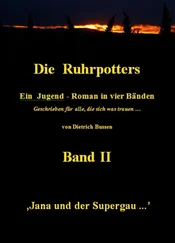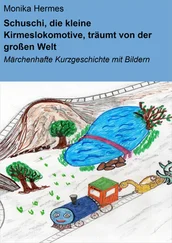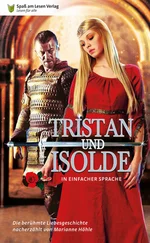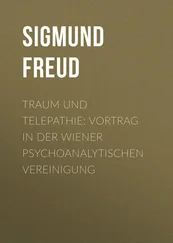»In Rienzi hat sich Wagner unbestreitbar als fähig erwiesen, sich die Merkmale der französischen Grand Opéra zu eigen zu machen. Rienzi bietet alle operndramaturgischen Zutaten, denen die Gattung ihren Erfolg verdankt: fesselnde dramatische Tableaus, Massenszenen, Aufmärsche, Aufzüge und Schwurszenen, Durchkreuzung einer privaten und einer politischen Handlung, deren Ausbreitung ihre epische Herkunft verrät.« 31
Carl Dahlhaus weist auf den Umstand hin, dass sich die Auseinandersetzung Wagners mit Modellen der Grand Opéra nicht nur in Rienzi, sondern bis in das Spätwerk nachverfolgen lässt, 32und schlägt dabei auch den Bogen zum »Gesamtkunstwerk«, dessen Grundzüge sich in der literarischen und musikästhetischen Diskussion in Paris bereits ab Beginn des zweiten Drittels des 19. Jahrhunderts herausbilden. Matthias Brzoska konstatiert in diesem Zusammenhang:
»Daß die Idee des Gesamtkunstwerks in wesentlichen Aspekten auf Prämissen französischen Ursprungs fußt, kann mithin als erwiesen gelten; sie wurzelt in jener literarischen Krisensituation, die für die zweite Generation des Romantisme charakteristisch ist und den Übergang zum Realisme markiert. Und daß sich Wagner trotz der damit verbundenen Enttäuschungen immer wieder an Paris orientierte, erscheint ebenso konsequent wie die Tatsache, daß er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gerade unter Pariser Literaten glühende Anhänger fand.« 33
Sieht Theodor W. Adorno in Wagner hinsichtlich musikalischer »Effekthascherei« den »Erben« Meyerbeers, 34so ist Offenbachs musikalische Auseinandersetzung mit den Werken des Hauptvertreters der Gattung der Grand Opéra nahezu ausschließlich auf parodistischer Ebene zu verorten. Offenbachs kompositorisches Denken setzt vielmehr bei den Prinzipien der älteren Opéra comique an, die er wiederbeleben und erneuern möchte. Ausgehend von diesem »genre primitif et vrai« 35entwickelt Offenbach sein Erfolgsmodell der mittleren Schaffensperiode, das Peter Hawig wie folgt umschreibt:
»Die ›Offenbachiade‹ ist ein satirischer Seitenzweig der opéra-comique: die Gesellschaftssatire in Gestalt des Musiktheaters. Sie ist ein wohldosiertes Gemisch musikalischer Traditionsbausteine mit parodistischer Zuspitzung, in denen aber immer die Inseln der aufrichtigen Gefühle selig vor sich hintreiben.« 36
In nicht-parodisierender Weise setzt sich Offenbach lediglich zweimal mit dem Modell der Grand Opéra auseinander: In den Rheinnixen und zehn Jahre später in seiner »verhinderten Großen Oper«, 37der Bühnenmusik zu Victorien Sardous Drama La Haine (1874). 38Insbesondere in den Rheinnixen sind – neben der Grand Opéra – auch Merkmale anderer Gattungen, wie beispielsweise der Opéra comique oder der Romantischen Oper, nachweisbar. Den Einsatz verschiedener Traditionsbausteine behält Offenbach, wenn auch in reduzierter Form, in den folgenden Werken bei und führt ihn im Spätwerk Les Contes d’Hoffmann nochmals zu einem Höhepunkt, indem er die Gattungsmischung als wesentliches stilistisches Charakteristikum seiner Opéra fantastique exponiert.
Wagner hingegen vollzieht – nach der frühen Beschäftigung mit den Gattungen der Romantischen Oper in den Feen (Fertigstellung 1834), mit der Opéra comique und der Opera semiseria in Das Liebesverbot (1836) und ausgehend von der Adaption des Modells der Grand Opéra in Rienzi (1842) – die schrittweise sich steigernde Individualisierung der Musiksprache der nachfolgenden Werke. Und genau hierin sieht beispielsweise Friedrich Nietzsche – noch in der Phase seiner Bewunderung für den Komponisten – die größte Leistung des Musikdramatikers Richard Wagner:
»Wer hinter einander zwei solche Dichtungen wie Tristan und die Meistersinger liest, wird in Hinsicht auf die Wortsprache ein ähnliches Erstaunen und Zweifeln empfinden, wie in Hinsicht auf die Musik: wie es nämlich möglich war, über zwei Welten, so verschieden an Form, Farbe, Fügung, als an Seele, schöpferisch zu gebieten. Diess ist das Mächtigste an der Wagnerischen Begabung, Etwas, das – allein dem grossen Meister gelingen wird: für jedes Werk eine neue Sprache auszuprägen und der neuen Innerlichkeit auch einen neuen Leib, einen neuen Klang zu geben.« 39
Die Einflüsse französischer Operntraditionen auf das Werk Richard Wagners erschöpfen sich jedoch nicht nur in den zuvor genannten dramaturgischen Mustern, wie beispielsweise die für die Grand Opéra maßgeblichen Massenszenen oder die Vermischung privater und öffentlicher Konflikte, sondern sie erstrecken sich auch auf genuin musikalische Modelle. Um nur ein Beispiel zu nennen: Gerade die mit dem Schaffen Richard Wagners so unauflösbar verknüpfte Konzeption der »Leitmotivtechnik« findet sich bereits in der Tradition der Opéra comique und der Grand Opéra vorgeprägt:
»Bei dem Versuch, Wagners historische Rolle für die Entwicklung der Motivtechnik in der Oper möglichst präzise zu beschreiben, sollte man einerseits nicht der Suggestion des von Wagner selbst entworfenen Geschichtsbildes erliegen und sich andererseits bewußt machen, daß gerade hier der Komponist eine bemerkenswerte Zurückhaltung bewies und den Terminus ›Leitmotiv‹ stets vermieden hat. Als Wagner für das musikalische Theater zu komponieren begann, kannte dieses seit langem sowohl eine hochentwickelte Technik der motivischen Verarbeitung, als auch ein nicht minder perfektioniertes Verfahren semantischer Verknüpfungen mittels Motiven; für beides bildete die französische Oper das hauptsächliche Experimentierfeld. Wagner brauchte hieran nur anzuknüpfen, und nichts anderes hat er in seinen frühen Opern denn auch getan.« 40
Und Carl Dahlhaus formuliert in diesem Zusammenhang mit Blick auf Les Contes d’Hoffmann die weitreichende, bis heute noch einzulösende Forderung:
»Es wäre an der Zeit, eine Geschichte des Erinnerungsmotivs in der Oper zu schreiben, die sich von dem Zwang befreit, um Wagners Leitmotivtechnik zu kreisen. Daß gewissermaßen das Erinnerungsmotiv von Wagner zum Leitmotiv ›generalisiert‹ wurde – und nur als ›generalisiertes‹, also seit Rheingold, sollte es überhaupt ›Leitmotiv‹ genannt werden -, war für die nach griffigen Formeln suchende Musikkritik des 19. Jahrhunderts, der sich die Geschichtsschreibung unreflektiert anschloß, ein genügender Grund, die Erinnerungsmotivik, die es doch vor, neben und nach Wagner – und zwar unabhängig vom Musikdrama – in vielfältigen Ausprägungen gab, auf die Leitmotivtechnik zu beziehen, sei es als Vorform, als Parallele oder als ›Wirkung‹. Die Funktion der Erinnerungsmotive bei Mussorgskij, Massenet oder Offenbach – um einige extrem verschiedene Komponisten zu nennen – wird jedoch dadurch, daß man bei einem Interpretationsversuch sich offen oder latent an Wagner orientiert, eher verdunkelt als erhellt.« 41
Genau auf diese aus der Tradition der Opéra comique stammende Technik der Erinnerungsmotivik greift Offenbach, wie später noch ausführlich analysiert werden wird, in seiner Großen romantischen Oper Die Rheinnixen im Jahr 1864 besonders eingehend zurück – gut fünf Jahre vor der Uraufführung von Wagners Rheingold im September 1869.
1.2 Offenbach contra Wagner in Selbstzeugnissen
Es gibt keinen Beleg dafür, dass sich Richard Wagner und Jacques Offenbach jemals persönlich begegnet sind. Verstreute Zeugnisse direkter Bezugnahmen aufeinander finden sich in Briefen, Schriften und in Form einer musikalischen sowie einer literarischen Parodie. Einige dieser Dokumente, von denen eines auch die Geschehnisse der Streichung von Tristan und Isolde und der Uraufführung der Rheinnixen an der Wiener Hofoper im Jahr 1864 betrifft, sollen im Folgenden in chronologischer Anordnung herausgegriffen und beleuchtet werden.
Den Beginn des Schlagabtausches beider Komponisten macht Offenbach mit seiner am 10. Februar 1860 im Théâtre des Bouffes-Parisiens aufgeführten parodistischen Faschingsrevue Le Carnaval des revues. Unmittelbar zuvor veranstaltet Richard Wagner, um seine Opern in Paris bekannt zu machen, im Théâtre Italien am 25. Januar, 1. und 8. Februar 1860 drei Konzerte, in denen neben Auszügen aus dem Fliegenden Holländer (1843), Tannhäuser (1845) und Lohengrin (1850) auch das Vorspiel zu Tristan und Isolde mit dem von ihm hierfür neu komponierten Konzertschluss 42erklingen.
Читать дальше