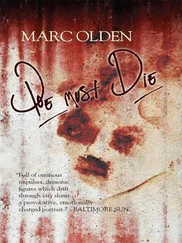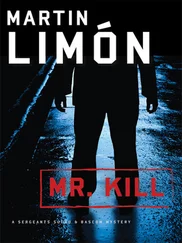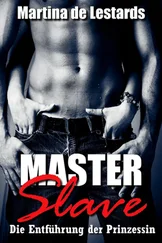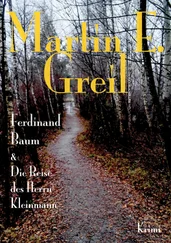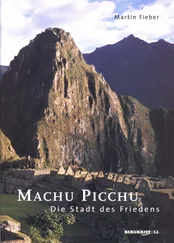Sie liefen schon eine halbe Stunde, als Frau Meier sagte: „Karl, wir müssen da lang!“ Sie deutete nach rechts einen schmalen Pfad entlang.
Karl zog eine alte Wanderkarte aus der Tasche und studierte sie. „Nee, wir müssen links bleiben, Gertrud.“
„Aber ich bin mir sicher!“, erwiderte seine Frau.
„Ich hab die Karte – und nach der müssen wir hier lang.“
„Aber Karl, ich bin mir wirklich sicher. Letztes Jahr als wir …“ Sie verstummte. Zwei Wanderer kamen ihnen entgegen. Frau Meier ging dem Mann und der Frau ein paar Schritte entgegen und sprach sie ohne Umschweife an. „Grüß Gott! Können Sie uns vielleicht helfen?“ Berührungsängste kannte Frau Meier nicht.
Die Frau musterte sie aus wachen Augen. „Guten Tag. Was wollen Sie?“ Ihr Ton war nicht unfreundlich, aber auch nicht einladend. Eher kühl.
„Die Nahgoldtalsperre? Da lang oder hier auf dem Weg bleiben?“
Der Mann antwortete anstelle der dunkelhaarigen Frau. „Sie müssen auf dem Weg bleiben. In etwa einem Kilometer müssen Sie dann rechts ab.“
„Siehst du, wir müssen hier weiter“, triumphierte Herr Meier.
„Na gut, dann komm!“ An das Wandererpärchen gewandt sagte seine Frau: „Danke und schönen Tag noch.“
Mit diesen Worten verschwanden die Meiers gen Osten. Die Wanderer blickten ihnen nach, bis sie außer Sicht waren, dann lenkten sie ihre Schritte weg von dem befestigten Weg hinein in das Dickicht des Waldes. Das Unterholz war sehr dicht. Es fiel ihnen schwer, geradewegs nach Norden zu laufen. Gelegentlich zogen sie einen Kompass zurate, um ihre Richtung zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.
Nach einer weiteren halben Stunde wurde das Gestrüpp am Waldboden lichter. Sie erreichten einen Platz mit vier Bäumen, die in einem fast symmetrischen Quadrat angeordnet waren. In ihrer Mitte befand sich ein runder Holzdeckel, wie der Verschluss eines Kanals.
Der hochgewachsene Mann hob den Deckel an. Darunter kam ein dunkler Schacht zum Vorschein. Er nahm einen herumliegenden kleinen Ast und warf ihn in die Dunkelheit. Es dauerte etwa vier Sekunden, bis er auf dem Boden aufschlug. Die Frau zog ihren Rucksack ab und holte ein Seil heraus. Sie entfernte Blätter und Erde vom Rand des Schachts, bis sie einen Eisenring in Händen hielt. Sie befestigte das Seil an dem Ring, zog ein paar Mal mit aller Kraft daran, bis sie sicher war, dass es festsaß. Dann warf sie es in die Finsternis des Abgrunds.
Der Mann wickelte sich das Seil um das linke Handgelenk, dann ließ er sich in das dunkle, gähnende Loch hinabsinken. Er stützte sich mit den Füßen an der Wand ab, dabei ließ er das Seil langsam durch seine Hände gleiten. Die kleine Stirnlampe, die er sich auf den Kopf gesetzt hatte, spendete genug Licht, um die vor ihm liegende Wand zu erhellen.
Nach ein paar Minuten, etwa in fünf Metern Tiefe, wurde der Lichtstrahl von einem zweiten Metallring reflektiert. Er löste die rechte Hand vom Seil, legte sie um den Ring und zog daran. Ein leichtes Vibrieren ging durch den Erdschacht. Aus der Wand rechts unter ihm, schob sich eine Metallplattform heraus. Als das Vibrieren abebbte, war der Schacht unter ihm verschlossen. Er setzte die Beine ab, ließ das Seil los, hob den Kopf nach oben und rief: „Du kannst runter kommen!“
Kurz darauf stand seine Begleiterin neben ihm.
Die Lampe des Mannes richtete sich auf die Wand, aus der die Bodenplatte herausgeglitten war. Ein paar Sekunden irrlichterte der Strahl hin und her. Dann erfasste er ein schwarzes Viereck, eine Klappe, ungefähr zwanzigmal fünfzehn Zentimeter groß. Ein Griff in die linke Hosentasche des Mannes und eine Art Scheckkarte kam zum Vorschein. Er hielt sie vor das Viereck. Mit einem Klick sprang es auf. Eine dunkel glimmende Fläche kam zum Vorschein. Er legte seine linke Handfläche darauf. Ein weißer heller Strich entstand an seinen Fingerspitzen und fuhr die Handfläche hinunter. Unten angelangt verschwand er wieder. Für zehn Sekunden geschah nichts. Dann ging wieder ein Vibrieren durch den Schacht und die Wand vor den beiden glitt zur Seite. Sie gab den Blick auf einen hell erleuchteten Gang frei. Die beiden traten ein. Als sie etwa fünf Schritte die leicht abschüssige Röhre entlang gelaufen waren, schloss sich die Tür lautlos hinter ihnen.
Sie folgten dem Gang, von dessen Metallwänden ihre Schritte widerhallten. Es gab weder Abzweigungen noch Türen, außer am Ende des Hohlweges. Dort befand sich ein weiterer Handabdruckleser. Auch dieser gewährte ihnen Zugang. Die Tür glitt zur Seite und sie betraten einen Raum mit Schreibtischen, die durch Stellwände voneinander getrennt waren. An drei von den Tischen saßen Männer, die kurz aufsahen und sich dann wieder ihrer Arbeit widmeten. Die Neuankömmlinge wurden nicht weiter beachtet.
Die beiden wandten sich einer Tür auf der linken Seite des Raums zu. Die Frau klopfte kurz und trat ein.
In dem Raum hinter der Tür stand nur ein Schreibtisch. An ihm saß eine Person, die aufblickte, als die beiden hereinkamen. Der Mann setzte sich auf einen der beiden Besucherstühle und schlug die Beine übereinander. Dann begrüßte er die Gestalt hinter dem Schreibtisch: „Guten Morgen, Caligula.“
Montag, 17. März, 07:07, Frankfurt Flughafen
Der Flieger setzte zur Landung an. Die Räder der LH-666 berührten den Asphalt der Landebahn Nordwest des Frankfurter Flughafens. Ein leichter Ruck ging durch die Kabine. Einige der hundertachtzig Passagiere holten hörbar Luft, so auch die junge Frau neben Robert Esslinger.
„Keine Angst, das ist normal“, sagte er, ein Lächeln im Gesicht, das ein gepflegter Pfeffer-und-Salz-Bart zierte. Die Frau nickte flüchtig. Als das Flugzeug ausrollte, war die Erleichterung auf ihrem Gesicht nicht zu übersehen. Bevor die Dame ausstieg, nickte sie Esslinger noch einmal zu, packte ihren Trolly und ließ sich mit den anderen Gästen hinaustreiben.
Robert Esslinger und der Mann neben ihm am Fenster waren die letzten beiden Fluggäste in ihrer Reihe. Hinter ihnen saßen zwei weitere Herren in dunklen Anzügen. Ansonsten war die Kabine leer. Die Gruppe hatte absichtlich gewartet, bis sie alleine an Bord war. Esslinger wollte böse Überraschungen vermeiden.
„Kommen Sie, Winter! Jetzt können wir gehen“, forderte er den Schwarzhaarigen neben sich auf und nickte den beiden Anzugträgern hinter ihnen zu. Sascha Winter blickte Esslinger aus dunklen Augen an, sagte aber nichts. Der junge Mann wirkte weder beunruhigt noch nervös. Er schien völlig ausgeglichen. Ein Wunder bei dem, was hinter ihm liegt, dachte Esslinger. Winter hatte eingewilligt in einem sehr brisanten Fall auszusagen. Jeder andere an seiner Stelle wäre panisch oder paranoid geworden – nicht Winter.
Kurz bevor sie alle aufstanden, rieb sich Sascha Winter die linke Schulter. Eine Bewegung, die Esslinger in den letzten Tagen des Öfteren bei seinem Begleiter beobachtet hatte. „Schmerzen?“, fragte er.
„Unwesentlich“, kommentierte Winter knapp, während er sich erhob.
Am Ausgang des A-320 standen die beiden Stewardessen, die sie während des Fluges überaus freundlich bedient hatten.
„Danke, dass Sie mit uns geflogen sind. Beehren Sie uns bald wieder“, verabschiedete sich die Blondine, auf deren Namensschild Maurer zu lesen war. Den ganzen Flug über war sie sehr bemüht gewesen, vor allem um Winter. Esslinger musste zugeben, dass sein Begleiter sehr attraktiv war und bestimmt auf siebzig Prozent aller Frauen anziehend wirkte. Insgeheim verglich er Winters Aussehen mit Sebastian Stan, dem Darsteller des Bucky Barnes aus den Marvel- Filmen. Wie kam er nur auf diesen Vergleich? Ja, die Leidenschaft seiner Tochter, Comicverfilmungen. Kurz blitzte ein wehmütiger Gedanke an Jennifer in ihm auf. Seine mittlerweile erwachsene Tochter, die sich von ihm abgewendet hatte, und deren Zuneigung er zurückzugewinnen versuchte.
Читать дальше