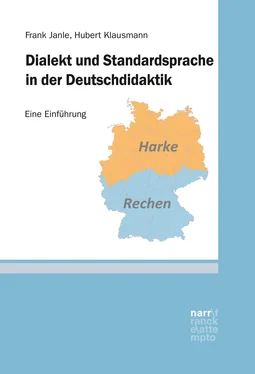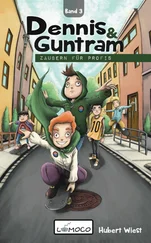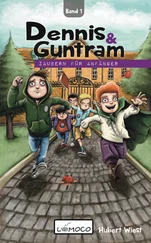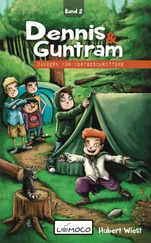In den Urkunden taucht die Diphthongierung, die sich dann später auch in der Schriftsprache durchsetzt, ab dem 12. Jahrhundert auf, zunächst in Kärnten, viel später, im 16. Jahrhundert, auch im FränkischenFränkisch und SchwäbischenSchwäbisch. Die alemannischenAlemannisch Dialekte haben sie nicht mitgemacht, so dass man dort in den Dialekten auch heute noch wie im Mittelalter die oben genannten Wörter als Huus , Zit/Ziit und Hiiser/Hüüser ausspricht. Da die Diphthongierung zuerst in Kärnten auftauchte, ging man lange davon aus, dass sie in Kärnten entstand und sich langsam von dort bis in den schwäbischSchwäbisch-fränkischen Sprachraum ausbreitete. Doch schließt man bei dieser Theorie zu einfach von der Schreibweise der Schreiber auf die gesprochene Sprache, was nicht zulässig ist. In der Sprachwissenschaft geht man heute vielmehr von einer Entwicklung aus, die an mehreren Stellen gleichzeitig geschah und sich lediglich zeitlich unterschiedlich in den schriftlichen Texten niederschlug.
Die folgende Tabelle zeigt noch einmal, wie sich allein durch die Teilnahme an der neuhochdeutschen Diphthongierung die süddeutschen Großdialekte unterscheiden lassen.
| Mhd. |
Alemannisch |
Schwäbisch |
Bairisch |
Fränkisch |
| hûs |
Huus |
Hous |
Haus |
Haus |
| zît |
Zit/Ziit |
Zeit |
Zait |
Zait |
| hiuser |
Hiiser/Hüüser |
Heiser |
Haiser |
Haiser/ Höüser |
Tab. 2: Die Aufteilung der süddeutschen Dialekte und die neuhochdeutsche Diphthongierung.
Jeder dieser Großräume wird dann mit Hilfe lautlicher Kriterien weiter unterteilt. Hier einige Hinweise zur weiteren Unterteilung:
AlemannischAlemannisch: Das Süd- oder Hochalemannisch genannte Gebiet, das ungefähr südlich einer Linie Freiburg-Konstanz beginnt und bis zum Alpenhauptkamm reicht, hebt sich durch die Verschiebung des k- Lautes in Chind „Kind“, Chalb „Kalb“ usw. von den übrigen alemannischen Dialekten ab. Das Oberrhein-Alemannische zeigt mit dem Wandel von - b - zwischen zwei Vokalen zu einem - w - in Wörtern wie „leben“, „Reben“, „sieben“ usw. und von - g - zwischen zwei Vokalen zu - ch - in Wörtern wie „sagen“, „Magen“, „Wagen“ einen stark fränkischenFränkisch Einfluss. Das Bodensee-Alemannische zeichnet sich seinerseits durch die Lautungen broat „breit“, Goaß „Geiß“, Soal „Seil“ usw. aus.
SchwäbischSchwäbisch: Das Schwäbische kann man durch die Lautungen der Wörter „breit“, „groß“ und „Schnee“ in vier Teilräume unterteilen: Westschwäbisch ( broat, grauß, Schnai ), Zentralschwäbisch ( broit, grauß, Schnai ), Ostschwäbisch ( broit, groaß, Schnäa ), Südschwäbisch ( broit/brait, grooß, Schnee ).
Bairisch: Das BairischeBairisch wird traditionell in Nordbairisch, Mittelbairisch und Südbairisch unterteilt. Typisch für das Nordbairische sind zum Beispiel die sogenannten gestürzten Diphthonge bei mhd. ou und mhd. öu , also die Aussprachen Kou „Kuh“ und Kei „Kühe“. Das Südbairische hat als Hauptmerkmal die binnendeutsche Konsonantenschwächung nicht mitgemacht, so dass dort die Laute b, d, g und p, t, k nach wie vor unterschieden werden. Es stehen sich dadurch südbairisches Kniä „Knie“ und mittel- und nordbairisches Gniä gegenüber. Für das gesamte BairischeBairisch typisch ist die „Verdumpfung“ eines alten mhd. a -Lautes zu einem o -haltigen Laut, den man als - å - wiedergeben könnte: Kåtz „Katze“. Als außerordentliche Besonderheit kennt das Gesamtbairische darüber hinaus auch noch Kennwörter, also Wörter, die es nur im bairischen Sprachraum gibt. Hierzu gehört zum Beispiel enk „euch“.
FränkischFränkisch: Hier gibt es verschiedene Unterteilungsmöglichkeiten, so zum Beispiel in Rheinfränkisch ( Appel „Apfel“, Phaal „Pfahl“), Südfränkisch ( Worscht „Wurst“, braait/breet „breit“, Schtuul „Stuhl“), Unterostfränkisch ( Rachä „Rechen“, Kaas „Käse“, ass „essen“) und Oberostfränkisch ( Woochä „Wagen“, braat „breit“, Schtual „Stuhl“).
Die soeben dargestellte Untergliederung war erst möglich, nachdem die Dialektatlanten fertiggestellt waren. Beim Durchblättern der Karten ergab sich dann, dass einige Karten immer die gleiche Raumverteilung zeigten. Dort, wo mehrere sprachliche Phänomene aufeinandertreffen, ergeben sich dann für die Dialektforschung die Dialektgrenzen. Wie aber kommt es zur Bildung solcher Dialektgrenzen?
3.1.3 Die Entstehung von Dialektgrenzen
Für die Entstehung von Dialektgrenzen gibt es mehrere Gründe. Einen ersten und für große Dialektgrenzen sehr wichtigen Grund bilden Siedlungsgrenzen. Hierbei ist allerdings darauf hinzuweisen, dass in der Frühzeit verschiedene Siedlergruppen oft noch relativ weit voneinander getrennt waren und zwischen den beiden Sprachräumen Ödland lag. Dieses wurde dann von beiden Seiten her besiedelt, bis die beiden Siedlergruppen an einer Stelle aufeinanderstießen. Und wenn beide Siedlergruppen unterschiedlich sprachen, bildete sich an dieser Stelle eine Sprach- oder Dialektgrenze. Die soeben geschilderte Entwicklung hat zum Beispiel an der Außengrenze des SchwäbischenSchwäbisch drei Mal stattgefunden: am Kniebis, wo oberrhein-alemannische Siedler aus den Seitentälern des Rheintals auf schwäbische Siedler aus dem Neckarraum stießen, im Raum Ellwangen, wo alemannische Siedler nach der Gründung des Klosters Ellwangen den Wald nördlich des Klosters solange urbar machten, bis sie auf das fränkische Siedlungsgebiet bei Crailsheim stießen, und am unteren Lech zwischen Augsburg und Donau, wo der relativ unbewohnte Raum zwischen Alemannen und Baiern erst recht spät intensiver besiedelt wurde, bis beide Sprachräume schließlich heute am Lech aufeinandertreffen. In einem engen Zusammenhang mit den Siedlungsgrenzen stehen die natürlichen Grenzen, wie man am Beispiel des Schwarzwalds sehen kann. Die Bedeutung solcher Grenzen für die Entstehung von Sprachgrenzen wird aber oft überschätzt. Was für den Schwarzwald stimmt, muss für Rhein, Donau und Lech nicht auch stimmen. Gerade beim Rhein, der heute als breiter Strom durch die Landschaft fließt, müssen wir daran erinnern, dass er bis zur Rheinregulierung durch Tulla im 19. Jahrhundert mit seinen zahlreichen Inseln und Flussarmen kein großes Verkehrshindernis darstellte, was dazu führte, dass Bauern auf beiden Seiten des Flusses Gelände besaßen und der Dialekt auf beiden Seiten des Rheins fast derselbe ist. Ähnlich war es am unteren Lech, wo nicht der Fluss, sondern Sumpf und Ödland, die dahinterlagen, die Siedlungstätigkeit einschränkten.
Alte Siedlungsräume schlagen sich häufig in der Aufteilung der alten Bistumsgrenzen nieder. Aber die alten kirchlichen Verwaltungen können aufgrund des Einflusses der Pfarrer auch direkt auf die Sprache einwirken. Bei allem, was mit der Kirche zu tun hatte, und hierzu zählen auch die Wochentage, konnte diese auf die Sprache der ihr unterstehenden Bevölkerung einwirken. So können wir zum Beispiel nachweisen, dass bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts die ostschwäbischeSchwäbisch Bezeichnung Aftermontag „Dienstag“ nur im alten Bistum Augsburg üblich war. Dort müssen sie die Pfarrer gegen die alte heidnische Bezeichnung Zistag , in der der Kriegsgott Zio verehrt wurde, durchgesetzt haben. Die Bezeichnung Aftermontag ist dagegen ganz neutral und bedeutet ganz einfach den Tag – man vergleiche englisch after – nach dem Montag .
Читать дальше