1 ...6 7 8 10 11 12 ...28
Parteiliche Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft
Soziale Arbeit ist ein Moment das Sozialstaatsprinzips moderner Gesellschaften, sie nimmt Aufgaben wahr innerhalb des arbeitsteilig organisierten Sozialstaates. Das Sozialstaatsprinzip war die Antwort auf die gesellschaftlichen Brüche in der modernen Industriegesellschaft, auf die ungleiche Verteilung von Besitz und Einkommen und auf die Probleme sozialer Desintegration, auf den Verlust traditionaler sozialer Systeme der Hilfe und Unterstützung (insbesondere der Familie) und die Überforderung traditionaler Hilfen (wie z. B. der Kirchen). Heute ist es die Antwort auf neue Formen von Entfremdung, Verarmung und Randständigkeit in der globalisierten Arbeitsgesellschaft. Dabei hat der Sozialstaat nicht nur marktausgelöste soziale Ungerechtigkeit zu kompensieren, sondern auch eine aktive Verteilungspolitik zu verfolgen (vgl. Schröer 2008:355). Das Sozialstaatsprinzip setzt auf die Würde des Menschen, auf ihre Anerkennung als Subjekte des Lebens, und es repräsentiert den Anspruch auf soziale Gerechtigkeit innerhalb einer Gesellschaft. Angesichts gesellschaftlicher Verhältnisse jedoch, die geprägt sind durch alte und neue Ungleichheiten und durch die zunehmende Brüchigkeit traditioneller Klassen und Milieus ist eine Vermittlung nötig, damit menschliche Würde und Anerkennung als Subjekt des Lebens realisiert werden können. Hier hat die Soziale Arbeit ihre spezifische Aufgabe (vgl. Thiersch 2002:11).
Thole (2012a:24) formuliert zunächst neutral, dass Soziale Arbeit stets ein institutionelles Angebot darstellt, das sich zwischen dem Staat als gesellschaftliches Gesamtsubjekt beziehungsweise in dessen Vertretung und Auftrag handelnde Organisationen auf der einen Seite und einzelnen Subjekten, Familien oder Gruppen auf der anderen Seite verortet. Der Sozialen Arbeit kommt dabei die Aufgabe zu, zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen System und Lebenswelt zu vermitteln, so Heiner, und sie bezeichnet dies als die ›intermediäre Funktion‹ der Sozialen Arbeit (vgl. 2004:155). Diese Vermittlung wird jedoch nicht neutral gesehen, vielmehr ist der spezifische Zugang der Sozialen Arbeit derjenige einer parteilichen Vermittlung: »Soziale Arbeit ist engagiert in den Problemen, die die Menschen in sich und mit sich selbst haben und erst in zweiter Linie an den Problemen, die die Gesellschaft mit ihnen hat. (Dafür sind im Rahmen unserer Gesellschaft Gesetz, Justiz und Polizei zuständig.) Soziale Arbeit vermittelt also zwischen Subjekt und Gesellschaft in der Perspektive des Subjekts« (Thiersch 2002:212). Sie sehe Menschen in ihren subjektiven Schwierigkeiten und Hoffnungen und ihren individuellen Anstrengungen, mit den vielfältigen Anforderungen des konkreten Alltags zurecht zu kommen. Und Gildemeister (1992:216) hält fest, die Soziale Arbeit sei der einzige Beruf, »der die Solidarität mit den Leidenden, Ausgestoßenen, Problembeladenen nicht aufgeben kann, ohne ein konstitutives Element zu verlieren«. Parteilichkeit für Klienten gilt als Maxime Sozialer Arbeit (vgl. Müller 1991:144).
Der Auftrag der Sozialen Arbeit sei ein nachrangiger, betont u. a. Heiner: In der sozialstaatlichen Arbeitsteilung soll die Soziale Arbeit in der Regel erst dann aktiv werden, wenn andere gesellschaftliche Systeme versagt haben beziehungsweise deren Problemlösungsansätze nicht greifen. Die Soziale Arbeit sei zuständig für alle Aspekte der komplexen Problemlagen der Klientel. Diese sozialpolitische Nachrangigkeit der Sozialen Arbeit, ihre Auffangfunktion als letztes soziales Netz der Gesellschaft führe dazu, dass sie es meist mit sehr komplexen, oftmals chronifizierten Problemlagen zu tun habe (vgl. Heiner 2004:156 f.).
Bearbeitung sozialer Probleme
In einer soziologischen und systemtheoretischen Perspektive wird der Sozialen Arbeit die Aufgabe der Bearbeitung sozialer Probleme zugewiesen (Gildemeister 1993; Staub-Bernasconi 2012). Soziale Arbeit wird dabei verstanden als Funktionssystem gesellschaftlicher Hilfen für Individuen und Gruppen, die von sozialen Problemen betroffen sind. Das setzt einen gesellschaftlichen Definitions- und Aushandlungsprozesse voraus, was als soziales Problem zu bezeichnen ist, wo Abweichungen von der ›Normalität‹ gesellschaftlicher Lebenspraxis als so gravierend beurteilt werden, dass (Ab-)Hilfe nötig ist – wann also ein soziales Problem zu einem Thema für die Soziale Arbeit wird. Anders als beispielsweise die Sozialpolitik geht Soziale Arbeit jedoch nicht direkt auf soziale Probleme ein, vielmehr bearbeitet sie die individuellen Probleme, die sich für Betroffene daraus ergeben. Es gehe ihr eher um »individualisierend ansetzende Maßnahmen« (vgl. Gildemeister 1993:59). Soziale Arbeit ist in dieser individuellen Perspektive »für das Wohlergehen, die Entwicklung und Selbstverwirklichung von Menschen zuständig. (…) Es geht also darum, Menschen zu befähigen, ihre Bedürfnisse so weit wie möglich aus eigener Kraft, d. h. dank geförderter und geforderter Lernprozesse zu befriedigen« (Staub-Bernsconi 2012:275 f.). Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten gilt als zentrales Grundprinzip in der Sozialen Arbeit.
Die Soziale Arbeit ist mit der lebenspraktischen Lage ihrer Klienten konfrontiert, die in komplexer Weise mit den Strukturen und Dynamiken der Gesellschaft zusammenhängt. Individuen, Familien und Gruppen in der Realisierung ihrer je eigenen Lebensentwürfe zu unterstützen, Bildungsprozesse zu ermöglichen, Chancen und Zugang zu Ressourcen zu eröffnen, das seien die wesentlichen Aufgaben Sozialer Arbeit, konstatiert Parpan-Blaser; diese allerdings bringen oft die Thematisierung gesellschaftlicher Strukturen und Ungleichheit mit sich, insbesondere dann, wenn gesellschaftliche Integration durch die kompensatorischen Hilfen der Sozialen Arbeit nicht mehr zu realisieren ist (vgl. 2005:135).
Ob die Soziale Arbeit neben der individuumsbezogenen Aufgabe auch ein politisches Mandat – also eine explizit gesellschaftsbezogene Funktion – hat, ist umstritten. Staub-Bernasconi (1995, 1998, 2007a, 2007b, 2012) tritt klar hierfür ein. Sie betont, dass sich die Soziale Arbeit in (sozial-)politische Entscheidungsprozesse einzumischen habe, um auf diese Weise dazu beizutragen, dass »menschenverachtende soziale Regeln und Werte von sozialen Systemen in menschengerechte Regeln und Werte« transformiert würden, damit Menschen überhaupt in die Lage versetzt werden, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Auch habe Soziale Arbeit die Aufgabe, öffentlichen Entscheidungsträgern Wissen über die Entstehung sozialer Probleme zur Verfügung zu stellen (vgl. Staub-Bernasconi 2012:276). Der Fokus bei der Bearbeitung von Problemen sei immer ein doppelter, so Heiner (2004:157): Es gehe sowohl um Veränderungen der Lebensbedingungen als auch der Lebensweise der Klientinnen. Diesen doppelten Fokus der Intervention hat bereits Alice Salomon (1926) formuliert. Für Heiner ist er ein Spezifikum der Sozialen Arbeit. Wenn die Aufgabe politischer Einmischung und Optimierung der sozialen Infrastruktur dazu gedacht werde – und hier bleibt sie in ihrer Positionierung offen –, dann lasse sich von einem ›trifokalen Fokus‹ der Sozialen Arbeit sprechen (vgl. ebd., auch Gildemeister 1992:209, u. a.). Staub-Bernasconi bezeichnet dies als Tripel-Mandat der Sozialen Arbeit (vgl. 2007b:12 f. –  Kap. 3.2.2.)
Kap. 3.2.2.)
Soziale Gerechtigkeit, Integration und Autonomie
Je nach theoretischem Entwurf wird der Auftrag der Sozialen Arbeit, zwischen Individuum und Gesellschaft aus der Perspektive des Subjekts zu vermitteln, mit anderen, weiteren Begrifflichkeiten umschrieben, die zugleich eine Zielsetzung beinhalten.
Es gilt als wesentliche Aufgabe der Sozialen Arbeit, soziale Integration zu unterstützen und immer wieder neu zu sichern, also den Zugang von Menschen zu allen relevanten Bereichen der Gesellschaft zu ermöglichen. Gemäß Böhnisch ist die Soziale Arbeit die gesellschaftlich institutionalisierte Reaktion in der Folge gesellschaftlich bedingter sozialer Desintegration (vgl. 2012:219). In seinem Konzept biografischer Lebensbewältigung kommt der Sozialen Arbeit die Aufgabe zu, individuelles Bewältigungshandeln zu verstehen und soziale Integration zu sichern, welche durch individuelles Bewältigungshandeln immer wieder aufs Spiel gesetzt werden muss. In systemtheoretischen Entwürfen wird die Funktion der Sozialen Arbeit bestimmt als Exklusionsvermeidung, Inklusionsvermittlung und Exklusionsverwaltung. Inklusionsvermittlung bedeutet, Zugang zu sozialen Systemen (z. B. Arbeitsmarkt, Bildungswesen, Gesundheitssystem) vermitteln und damit Exklusion zu verhindern. Gelingt die Inklusionsvermittlung in soziale Systeme längerfristig nicht, so tritt an ihrer Stelle die Exklusionsverwaltung, die Begleitung der Marginalisierten (vgl. Heiner 2004:157; Bommes/Scherr 2000:88 ff.). Basis des Integrationsgedankens ist die Vorstellung sozialer Gerechtigkeit (siehe oben, vgl. u. a. Schröer 2013; Thiersch 2002; Schütze 1992). Haupert bezeichnet die Soziale Arbeit als »Kerndisziplin der sozialen Integration«, deren Ziel die »Herstellung und Erhaltung sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit, bzw. die Kompensation entsprechender Ungerechtigkeiten« sei (2007:61 f.).
Читать дальше
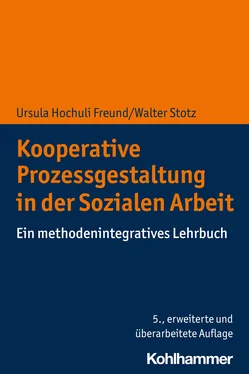
 Kap. 3.2.2.)
Kap. 3.2.2.)










