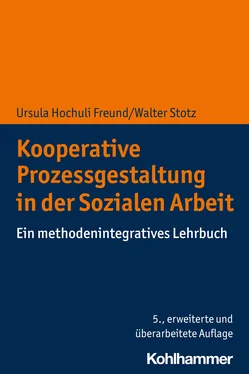Die Sozialarbeit hingegen hat sich aus der Armenfürsorge entwickelt und steht im Kontext der Herausbildung des Sozialstaates in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Hintergrund war auch hier die Entstehung der Industriegesellschaft und der mit ihr verbundenen sozialen Problemen. Das Armutsproblem verschärfte sich und verwandelte sich in die sog. ›soziale Frage‹, der allein mit polizei- und ordnungspolitischen Strategien nicht mehr begegnet werden konnte. Zuvor war die Armenpflege seit langer Zeit kommunal organisiert gewesen. Die Gemeinden waren zur Unterstützung der Hilfsbedürftigen verpflichtet. Voraussetzung allerdings war die Prüfung der Anspruchsberechtigung. Die materielle Unterstützung war knapp bemessen und an diskriminierende Umstände gebunden (vgl. Müller 2013:756, Hammerschmidt/Tennstedt 2012:74).
Bürgerliche Reformbestrebungen führten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – zumindest in den größeren Städten Deutschlands – dazu, dass diese materielle Hilfe ergänzt wurde durch eine individuelle Hilfe und Begleitung durch ehrenamtliche Bürger als sog. Armenpfleger. Durch diese kommunal organisierte und ehrenamtlich realisierte Hilfe von ›Mensch zu Mensch‹ veränderte sich die Armenfürsorge zur socialen Fürsorge: Dies war der erste Schritt auf dem Weg hin zur Sozialarbeit. In der Schweiz basierte die freiwillige Fürsorge für Arme auf privater, philanthropisch und religiös motivierter Wohltätigkeit von Einzelpersonen – oftmals bürgerlicher Frauen – und von karitativen Organisationen (z. B. ›Hilfsgesellschaften‹), die ebenfalls auf Privatinitiative zurückgingen. Der zweite Schritt bestand in der Einbindung der kommunalen Wohlfahrtspflege in den Wohlfahrtsstaat (vgl. Hammerschmidt/Tennstedt 2012:73 ff.). Im Zuge der Etablierung der Sozial- und Wirtschaftspolitik im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde die Armenfürsorge zunehmend zur Aufgabe des Staates. Diese Veränderung ist eng verknüpft mit den Anfängen der Sozialpolitik, welche die wichtigsten Daseinsrisiken durch Versicherungsleistungen abzudecken suchte. Die sog. Sozialversicherungen entstanden in Deutschland in den 1880er Jahren (Krankenversicherung, Unfallversicherung, Invaliden- und Altersversicherung – 1927 dann auch Arbeitslosigkeitsversicherung, vgl. Münchmeier 2013:366), in der Schweiz deutlich später (1918 Kranken- und Unfallversicherung, 1948 Alters- und Hinterlassenenversicherung, 1959 Invalidenversicherung, obligatorische Arbeitslosenversicherung erst 1983). Die finanziellen Transferleistungen der neuen (Arbeiter-)Versicherungen entlasteten die kommunalen Träger der Armenpflege und setzten Ressourcen frei. Darüber hinaus basierte die neue staatliche Armenpflege auf der Erkenntnis, dass auf die sozialen Probleme mit individuell ausgerichteter Hilfe reagiert werden muss: Mit ihren Prinzipien der Individualisierung, der Einzelfallhilfe und der persönlichen Beziehung zwischen Helferin und Hilfeempfänger vollzog sich eine Abkehr von einer nur auf materielle Sicherung bezogenen Hilfe (vgl. ebd.). Damit begann die erste Phase der Verberuflichung der ehemals meist weiblichen ehrenamtlichen Fürsorgetätigkeit durch die Gründung sog. ›sozialer Frauenschulen‹.
Neben einem hochgradig verrechtlichten, ökonomisierten und bürokratisierten System sozialer Sicherung – auf der Basis des Erwerbs individueller Anspruchsberechtigung – entstand also die moderne Sozialarbeit als personenbezogene Hilfe (vgl. Gildemeister 1993:60). Bis heute erfüllt Sozialarbeit Aufgaben im Bereich der Armutsbekämpfung und Existenzsicherung. Sie leistet dies einerseits mit materieller Hilfe (Geld- und Sachleistungen), andererseits mit immateriellen Dienstleistungen (Beratung, Unterstützung, Koordination von Hilfemaßnahmen). Die drei sog. ›klassischen Methoden‹ der Sozialarbeit – Einzelfallhilfe, soziale Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit – verweisen auf die Ausdifferenzierung der Praxisfelder der Sozialarbeit im Laufe des 20. Jahrhunderts. Dabei seien drei unterschiedliche Zielbestimmungen festzumachen (vgl. Becker et al. 2005:160 f.):
• Bearbeitung von Problemlagen, welche von den betroffenen Individuen, Familien, Gruppen oder Gemeinwesen nicht ohne fremde Hilfe gelöst werden können – sofern diese in einem politischen Entscheidungsprozess als zu lösende Probleme anerkannt und die entsprechenden rechtlichen und materiellen Grundlagen vorhanden sind,
• Bearbeitung von Problemen eines Gemeinwesens, ohne dass Betroffene um Hilfe ersucht hätten (u. a. auch Prävention und rechtspflegerische Kontrollaufgaben),
• Verbesserung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen (u. a. durch Gemeinwesenarbeit).
2.1.2 Soziale Arbeit als neuer Leitbegriff
Bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde an der Unterscheidung zwischen Sozialarbeit und Sozialpädagogik festgehalten, gleichzeitig wurde sie zunehmend hinterfragt. So bezeichnete Pfaffenberger bereits 1966 die Zweiteilung als historisch zufällig und überholt und skizzierte demgegenüber die Soziale Arbeit als »einheitliches Funktionssystem gesellschaftlicher Hilfen« (zit. in Chassé/von Wensierski 2004a:7). Zahlreiche Publikationen befassten sich in den darauffolgenden Jahrzehnten mit der Angemessenheit bzw. Überholtheit dieser Unterscheidung (vgl. u. a. Merten 1998, 2002, 2013; Mühlum 2001; Niemeyer 2012; Thiersch 2002). Merten (2013:762) verweist darauf, dass es nach wie vor keine allgemein geteilte Begriffsbestimmung gibt, was unter Sozialer Arbeit bzw. Sozialarbeit und Sozialpädagogik inhaltlich verstanden wird. Er unterscheidet analytisch insbesondere zwei kategorial verschiedene Positionen:
• Differenzansatz: Aus den je unterschiedlichen historischen Ursprüngen leiten sich auch sachlogische Differenzen zwischen Sozialarbeit und Sozialpädagogik ab, die bis heute relevant sind. In der theoretischen Diskussion ist die sog. Sozialarbeitswissenschaft hier zu verorten – z. B. Mühlum 2004, Staub-Bernasconi 2007a –, welche die Differenz gegenüber der erziehungswissenschaftlich geprägten und zu verortenden Sozialpädagogik betont und einen Anspruch als Grundlagentheorie der Sozialen Arbeit erhebt.
• Identitätsansatz: Trotz der differenten Wurzeln hat sich bis heute eine so starke Annäherung sowohl der theoretischen Reflexion als auch der Praxisfelder vollzogen, dass empirisch keine Unterschiede mehr festzustellen sind. Thole (2012a:20) beispielsweise argumentiert, dass die beiden Begriffe Sozialarbeit und Sozialpädagogik heute keine verschiedenen wissenschaftlichen Fächer mehr kodieren, und auch keine voneinander klar abgrenzbare Praxisfelder, und schließlich auch keine klar unterschiedlichen Ausbildungswege und -inhalte mehr. In ähnlichem Sinne resümiert Niemeyer (2012:147), es stehe zunehmend in Frage, ob es noch Sinn mache, zwischen Sozialarbeit und Sozialpädagogik nach Maßgabe angeblich unterschiedlicher Objektbereiche trennen zu wollen, und er konstatiert, das terminologische Problem sinke zu einem Scheinthema herab.
Die aktuellen Handbücher und Wörterbücher nehmen fast alle den neuen Leitbegriff im Titel auf: ›Glossar zur Sozialen Arbeit‹ (FHA 2005), ›Handbuch Soziale Arbeit‹ (Otto/Thiersch 2011), ›Grundriss Soziale Arbeit‹ (Thole 2012), oder ›Wörterbuch Soziale Arbeit‹ (Kreft/Mielenz 2013).
Wenn wir in diesem Lehrbuch über professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit nachdenken, dann gehen wir von der Position des Identitätsansatzes aus, davon, dass es heute keine entscheidenden Unterschiede mehr gibt zwischen Sozialarbeit und Sozialpädagogik – zumindest keine, die eine Unterscheidung in ›Professionelles Handeln in der Sozialarbeit‹ und ›Professionelles Handeln in der Sozialpädagogik‹ rechtfertigen würden. Im Hinblick auf die Berufsbezeichnung allerdings wirft die Aufhebung der Trennlinie zwischen den beiden Fächern Schwierigkeiten auf. Denn die traditionellen Begriffe Sozialarbeiter und Sozialpädagogin sind damit überholt, ohne dass eine neue prägnante Bezeichnung in Sicht wäre. ›Professionelle der Sozialen Arbeit‹ ist die nahe liegende neue Bezeichnung. Für die schriftliche Kommunikation erscheint dieser Begriff durchaus sinnvoll, in der mündlichen Kommunikation hingegen ist er ausgesprochen sperrig, und auch im Hinblick auf die Berufsidentität erscheint er nicht sonderlich geeignet. Wir nehmen an, dass sich in den kommenden Jahren eine neue Bezeichnung herauskristallisieren und etablieren wird. Derweil gehen wir pragmatisch mit der Übergangssituation um und verwenden alle drei Begriffe – Professionelle der Sozialen Arbeit, Sozialpädagogin, Sozialarbeiter – abwechslungsweise und synonym.
Читать дальше