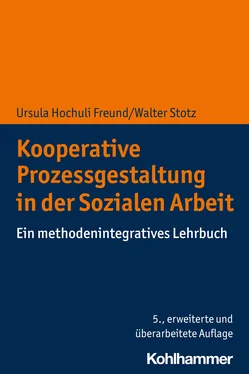Es gibt vier Rechtfertigungsgründe, die eine Weitergabe von Daten erlauben. Gesetzliche Rechtfertigungsgründe, die in Gesetzen und Erlassen als Mitteilungspflichten und -rechte geregelt sind, dienen vor allem bei Gefährdungen zum Schutz betroffener Menschen wie z. B. bei Kindesschutzgefährdungen. In Straf- und Zivilprozessordnungen gilt grundsätzlich für alle Personen Zeugnispflicht. In einigen Kantonen können auch Professionelle der Sozialen Arbeit ein Zeugnisverweigerungsrecht geltend machen. Ein dritter Grund kann durch die ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person selbst gegeben werden, und schließlich kann ein überwiegend öffentliches Interesse wie z. B. Amtshilfe, Zusammenarbeit, gesetzlicher Auftrag geltend gemacht werden. Es ist also im konkreten Fall oft eine Güterabwägung zwischen den Interessen der Schweigepflicht (insb. Vertrauensschutz) und dem Interesse an der Datenweitergabe zu treffen. (Vgl. Pärli 2008:136 f.).
Daten und Vertrauensschutz in der Bundesrepublik Deutschland
Professionelle der Sozialen Arbeit sind zum umfassenden Daten- und Vertrauensschutz verpflichtet. Dieser ist strafrechtlich abgesichert. Sozialarbeiterinnen sind nur entbunden, wenn der Betroffene einer Datenübermittlung zugestimmt hat oder eine gesetzliche Norm dies zulässt oder vorschreibt. Bezüglich des Zeugnisverweigerungsrechts gibt es keine eindeutige Regelung. (Vgl. Trenczek et al. 2008:534 f.)
4.3 Zusammenfassung der Erkenntnisse
Soziale Arbeit richtet sich in ihrer Zielsetzung immer nach bestimmten Werten und Normen, fragt nach dem Sinn ihrer Tätigkeit; zudem ist der sozialarbeiterische Alltag oft durch moralisch verzwickte Situationen gekennzeichnet. Zielsetzungen, Sinnorientierung, Werte, Normen verlangen eine kontinuierliche, kritische, ethische Reflexion. Diese Reflexion ist auf der Ebene der Praxis, der Wissenschaft, der wissenschaftstheoretischen Grundlegung, der Methoden der Sozialen Arbeit wie auch auf der Ebene der Professionsethiken der Berufsverbände anzustellen. Da Soziale Arbeit immer auf einem bestimmten Bild vom Menschen fußt, stellt es eine Voraussetzung für Sozialpädagogen dar, sich in transparenter Weise mit ihrem Menschenbild auseinanderzusetzen. Dabei ist davon auszugehen, dass sich Menschen in einem lebenslangen Entwicklungsprozess befinden. Mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948) wird stipuliert, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das bedeutet, Menschen dürfen nicht instrumentalisiert werden, ihre Würde wird erfahrbar in der Achtung ihrer Einzigartigkeit in jeder Interaktion und im Erreichen und Erhalt von größtmöglicher Autonomie. Menschenrechte werden angesehen als persönliche Freiheitsrechte, politische sowie kulturelle oder soziale Rechte, die in engem Zusammenhang mit der Grundfigur von Freiheit, Gleichheit und Teilhabe stehen. Neben den Menschenrechten gilt in der Sozialen Arbeit der Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit. Gemeint sind damit das Gewährleisten von gleichen Rechten, der Ausgleich von Leistungen sowie die Verteilungsgerechtigkeit. Damit korrespondiert die Idee der Solidarität im Sinne einer Beistandssolidarität als einer grundsätzlichen Verpflichtung gegenüber den Ansprüchen Benachteiligter und Hilfebedürftiger. Diese Grundwerte bilden einen Orientierungsrahmen für das professionelle Handeln, das sich gleichzeitig für eine nachhaltige Sicherung von Menschenwürde und sozialer Gerechtigkeit einsetzt und seine Funktion immer nur in subsidiärer Art und Weise versteht unter dem Motto ›Hilfe zur Selbsthilfe‹. Professionelle haben auf dieser Grundlage das eigene Handeln nach Person und Situation auszurichten und die jeweiligen Konsequenzen auf verschiedenen Bereichen mitzubedenken. Es gilt die Verantwortung gegenüber den Klientinnen, der Gesellschaft, dem Anstellungsträger, den Sozialarbeiterinnen, der Profession wie auch der eigenen Person wahrzunehmen. Sozialpädagogen sehen sich im Alltag immer wieder Dilemmasituationen ausgesetzt (moralische Konflikte), die abgestützt auf ein gesichertes Professionsverständnis und in Anbetracht der asymmetrischen Grundstruktur des Hilfeprozesses so zu lösen sind, dass die ausgehandelten Zielsetzungen in kooperativer Weise erreicht werden. Hilfreich ist hier ein strukturiertes Vorgehen zu ethischer Entscheidungsfindung. Care-ethische Positionen lenken den Blick auf das Ausbalancieren dieser Asymmetrie und weisen auf drei Grundmuster ethischen Handelns hin: In Anbetracht der Situation vieler Hilfebedürftiger ist eine Haltung von Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Anwaltlichkeit (advokatorische Ethik) gefordert, die ermöglicht, den Blick nicht nur auf die Notlage und Benachteiligung, sondern auch auf Ressourcen im ganzen System zu richten.
Insgesamt ist in Bezug auf das professionelle Handeln wichtig zu wissen, welche Rechte Klientinnen wie auch Professionelle der Sozialen Arbeit grundsätzlich haben. Dieses Wissen bildet einen Orientierungsrahmen für die Professionellen, das eigene Handeln abzusichern, mögliche Verletzungen geltend zu machen, sich aber auch vor unangemessenen Forderungen seitens der Politik wie der Klienten schützen zu können. Es gilt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sich professionelles Handeln immer auf rechtliche Grundlagen abzustützen hat, demnach die Rahmenbedingungen des Handelns danach abzuprüfen sind. Die verbrieften Gesetze, Verordnungen etc. schaffen für Sozialarbeiter einen großen Spielraum, der nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip und der höchstmöglichen Selbstbestimmung der Klientinnen zu gestalten ist. Dabei ist auf das Einhalten der Verfahrensgrundsätze zu achten, um eine größtmögliche Transparenz der Unterstützungsprozesse zu erreichen. Die Einhaltung der Anliegen zur Wahrung der Menschenrechte, das Recht auf Wahrung der Menschenwürde ist in jedem Handlungsschritt, auch im äußersten Fall von Inklusionsvermittlung (wie z. B. im Justizvollzug) anzustreben. Dazu gehört der sorgfältige Umgang mit persönlichen Daten (Datenschutz).
Lob-Hüdepohl, Andreas (2007). Berufliche Soziale Arbeit und die ethische Reflexion ihrer Beziehungs- und Organisationsformen. S. 113–16 in: Lob-Hüdepohl, Andreas/Lesch, Walter (Hg.). Ethik Sozialer Arbeit. Schöningh, Paderborn/München/Wien/Zürich.
Marti, Adrienne/Mösch Payot, Peter/Pärli, Kurt/Schleicher, Johannes/Schwander, Marianne (Hg.) (2009). Recht für die Soziale Arbeit. Grundlagen und ausgewählte Aspekte. 2. aktualisierte Auflage. Haupt, Bern/Stuttgart/Wien.
Trenczek, Thomas/Tammen, Britta/Behlert, Wolfgang (2008). Grundzüge des Rechts. Studienbuch für soziale Berufe. Reinhardt, München/Basel.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.