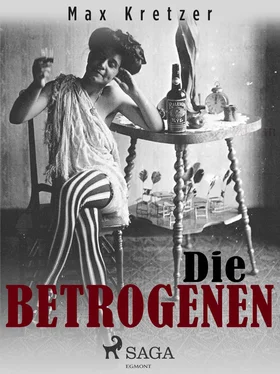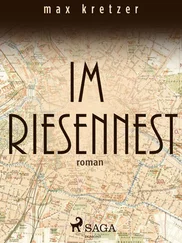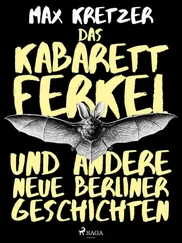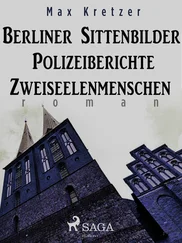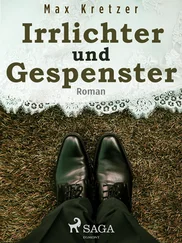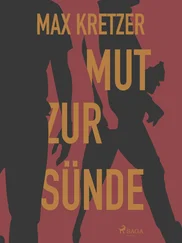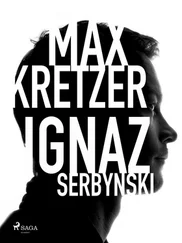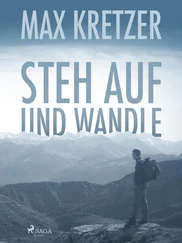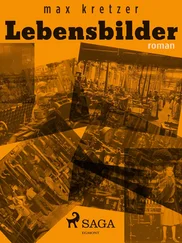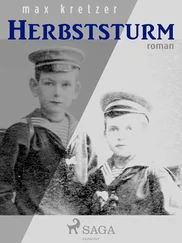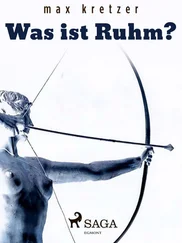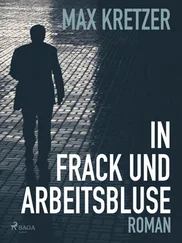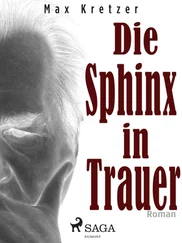Diese Dummen, die nie alle werden wollen!
Und dieser Lärm des Sich-gehen-lassens, diese Sucht nach Genuss und Betäubung, die in den Kneipen bereits feste Formen angenommen hat, zeigt sich auf den Strassen erst in ihrer Gährung. Das ist ein Ueberhasten, ein Ausweichen und Stossen, ein Zur-Schau-tragen einer gewissen Ruhelosigkeit, als könne man nicht die Zeit erwarten, bis man am Zechtisch sitzt, um mitzuarbeiten an der — Verrottung der Gesellschaft.
Brendel befand sich inmitten dieses Beobachtungsmaterials für den Sittenschilderer, ohne dass es für ihn Interesse gehabt hätte. Er war wie die meisten jungen Männer seines Schlages nur empfänglich für Genuss. Er hatte sich bald hier, bald da nach einem Mädchen umzusehen und machte darin zwischen öffentlichen Dirnen und anständigen Frauenzimmern keinen Unterschied.
Einmal blieb er vor einer aufgeputzten, geschminkten Gestalt stehen.
„Na Hedwig, wie geht es Dir?“ frug er vertraulich.
Das Mädchen war erfreut, lächelte und trat dicht an ihn heran.
„Ich danke. Wohin wollen Sie? Begleiten Sie mich —.“
„Kann heute nicht. Adieu Kleine, auf Wiedersehen.“
Man trennte sich kurz und freundlich. Er war mit dieser Art Mädchen ebenfalls sehr bekannt, denn er wohnte in diesem Viertel, das der Fabrik am nächsten lag, und war ein ständiger Besucher des Wiener-Cafés, dem nächtlichen Markte der Hetären.
An der Oranienstrasse bestieg er die Pferdebahn, um seinem Ziele zuzufahren. Nach einer halben Stunde sehen wir ihn in eine der vielen Studentenkneipen der Friedrichsstadt treten. Sie führte die Firma „Zum Falstaff“. Vorher hatte er von einem Blumenmädchen, das an einer Laterne stand, eine rothe Rose gekauft, die er kokett im Knopfloch seines Jaquets befestigte.
Als er in das im ersten Stockwerk belegene Lokal trat, scholl ihm jenes halbgedämpfte wirre Gemurmel von Stimmen entgegen, das immer den Beweis für den regen Besuch einer derartigen Kneipe giebt. Trotz der theilweise geöffneten oberen Fenster lagerten Wolken Cigarrendampfes um die Milchglasschalen der Gasflammen, die die drückende Wärme des Sommerabends noch weniger angenehm machten. Ein Blick durch die aneinanderhängenden Räume lehrte Brendel, dass das Lokal stark besetzt war. Man zechte stumm, spielte den üblichen Skat oder debattirte laut. Dazwischen ertönte abwechselnd der Ruf nach der Bedienung, nach Bier, oder erschallte die helle Klingel, welche die Mamsells nach dem Buffet rief, um bestellte Speisen oder Getränke entgegen zu nehmen.
Der Volontair der Firma Rother und Sohn durchschritt die ersten Zimmer bis zu einem am äussersten Ende gelegenen, in dem er einen Platz zu finden hoffte. Dabei trug er sein dünnes Stöckchen wie eine mit der Spitze nach unten gekehrte Lanze und lüftete das Haupt, um den Blicken der zu beiden Seiten sitzenden Gäste das glänzende, gescheitelte Haar preiszugeben.
Im Rahmen der ausgehobenen Thür kam ihm die Mamsell entgegen, die in diesem Revier bediente. Sie trug in der Rechten ein paar leere Gläser, sah ihn nicht kommen und wäre beinahe mit ihm zusammengestossen.
„Ach, der gute Leo! Wie geht’s, Kindchen? Was macht Edmund? Was trinken Sie, Dunkles oder Helles?“ brachte sie hintereinander hervor, ohne erst die Antwort auf jede einzelne Frage abzuwarten.
„Bitte, Dunkles — bringen Sie sich auch gleich einen Schoppen,“ bestellte Leo, die Hand der Kellnerin drückend.
„Nehmen Sie dort rechts Platz.“ Dann eilte sie hinweg.
„Lina,“ rief er ihr nach, „bringen Sie mir doch auch die Speisenkarte!“
Dann sah er sich nach einem Platz um. An einem kleineren Tisch waren noch einige Plätze frei. Es sass nur ein Herr mit ausdrucksvollem Gesicht an ihm, der die Beine von sich gestreckt hatte und nicht besonders gut gelaunt schien, denn er zeigte eine üble Miene und starrte abwechselnd sein Glas an.
„Sie erlauben —?“ wurde er jetzt von Brendel höflich gefragt, der an einem Stuhl rückte.
„Bitte —.“ war die ebenso höfliche Antwort, von einer Handbewegung begleitet.
Brendel zog noch im Stehen die hechtgrauen Handschuhe ab, dann setzte er sich und griff in die Tasche zu seinen Haarbürsten, dabei musterte er mit einem raschen Blick die um ihn Sitzenden.
An der hintersten Wand auf einem kleinen Ledersopha zurückgelehnt sassen ein paar Künstler, die fleissig rauchten und beobachteten, hin und wieder zusammen sprachen. Der eine von ihnen, der mit dem dunklen, kurzgestutzten Vollbart war Oswald Freigang; der andere zeigte auf breiten Schultern einen mächtigen Kopf mit von Pockennarben zerrissenem Antlitz, umgeben von einer hellblonden Mähne, die in ihrer Ueppigkeit an die eines Löwen erinnerte. Das war der Heiligenmaler Hannes Schlichting. Vor ihm neben seinem Glase lag ein lederner Schnürbeutel, gefüllt mit türkischem Tabak, aus dem er sich in gewissen Zwischenräumen eine kleine, braun angerauchte Meerschaumpfeife stopfte — die unzertrennliche Freundin seines Lebens, seiner Arbeit, seiner Kunst. Es lag etwas Schwerfälliges, halb Unbeholfenes im Wesen dieses Mannes, das ihn im Verein mit dem entstellenden Merkmal einer späten, schlecht geheilten Krankheit nicht übersehen liess. Wie er den riesigen Oberkörper drehte und wand, wie er den Ellenbogen ungenirt auf den Tisch stützte und die grosse Hand in das Haar vergrub — das diente zur scharfen Charakteristik eines Menschen, das waren noch alte, unverwischbare Angewohnheiten jener Zeit, als er auf der rothen Erde Westfalens den Acker seines Vaters, eines kleinen Bauern, pflügte. Man konnte Hannes Schlichting nicht mehr vergessen, man musste sich ihn dem Auge einprägen für ewige Zeiten, wenn man ihn einmal gesehen hatte. Man sah in dieses längliche Gesicht mit dem kaum merklichen spärlichen Schnurrbart, man sah die unzähligen, tief eingegrabenen Pockennarben, die es zerfetzt hatten, man hörte sein lautes, stossweise hervorquellendes Lachen und man fand beim ersten Blick, dass die Unschönheiten eines Menschen nicht auffallender zu Tage treten konnten. Man wandte die Augen fort, um sie doch wieder auf Johannes Schlichting ruhen zu lassen. Dieser Kopf zog an, je mehr er abstossen sollte. Es war das Gepräge des Geistes, der Stempel einer ausgesprochenen Individualität, der zuletzt die Pockennarben verschwinden, die Unmanieren nicht merken und nur noch scharfe, edle, sympathische Linien sehen liess — die Gesammterscheinung in ihrer charakteristischen, originellen Form.
Hatte man ihn dann erst näher kennen gelernt, erfahren, was für ein biederer Sinn, welch ein kindliches Gemüth in dieser äusserlich so vernachlässigten derben Hülle steckte, dann gewann man ihn lieb, man fand ihn schön, man vermisste etwas, wenn man ihn nicht sah und ihn nicht hörte in seiner breiten Mundart, mit seinem derben naiven westfälischen Humor.
Er war ein wenig Pessimist, der gute Hannes, trotz seinem unerschütterlichen Glauben an das dereinstige Fortleben seiner Kunst, wenn Genre, Landschaft und Historie schon längst als verbraucht das Zeitliche gesegnet haben sollten.
Und doch fühlte er in seinem Innern, wie der tosende Schrei der Zeit seine Ideale übertönte, wie er lärmend über die Satzungen der Bibel hinweg nach Greifbarem, Wahrem, nach der nackten Materie rief. Das machte sein Herz innerlich bluten, liess ihn aber nie energisch dagegen protestiren. Er fürchtete, man könne ihn nicht verstehen. Er besass auch einen zu glücklichen Humor, als dass man ihm einen zu grossen Ernst zugetraut hätte.
Das Höchste, was er in solchen Augenblicken zu sagen vermochte, wurzelte in einem stereotypen Satz.
„Bruder,“ pflegte er zu Freigang zu sagen, „’s ist halt nichts mehr mit der Kunst, ’s ist nur noch ’ne Zeit für Dampf und Qualm, ’s ist Alles Dampf und Qualm.“
Und als müsste er diesen Worten noch eine bildliche Bestätigung geben, dampfte er ärger denn je aus seiner Pfeife.
Читать дальше