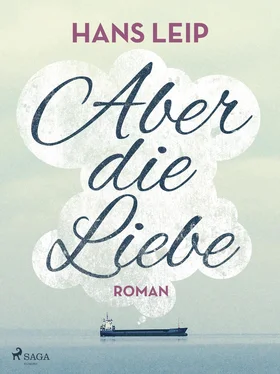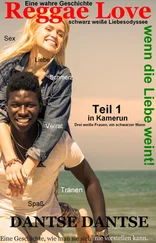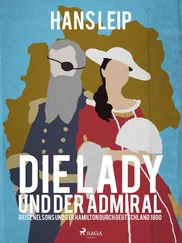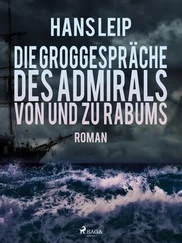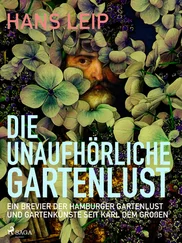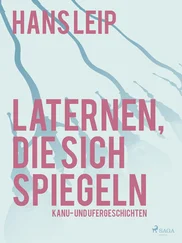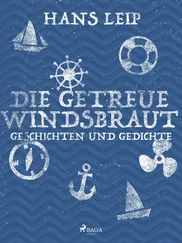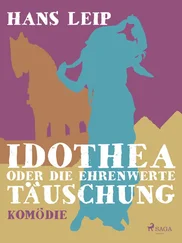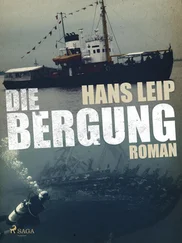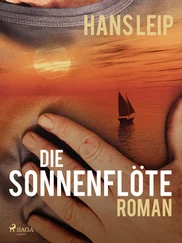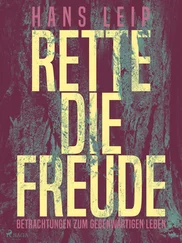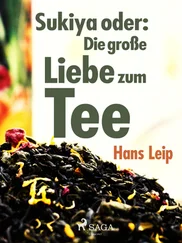1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 Ganz recht, Mister Bit, dieser Rotspon stammt aus Gefilden, die noch keinem Vertreter chemischer Spritzmittel zum Opfer gefallen sind und keine Pantscherei kennen. Und ist sicherlich hinreichend wogengeschaukelt, vielleicht sogar noch zu Zeiten des Laeiszdirektors Ganzauge einmal um die Erde gelangt, mit den letzten unvergeßlich malerischen Weizenseglern. Unser Container-Reeder wußte, was er uns an Bord vorzusetzen wagen durfte. Und es müssen Holzgebinde sein, darin solch Tropfen sich lagert und heranreift. Das ist die zweite Traubenreife, die innere, nach der sommerkurzen der ersten, die lange lange Zeit. Bis dann die dritte Reife und die allerfeinste sich gelegentlich vollzieht, die hohe Vergeistigung in jenen, die danach sind.
Sind wir danach, Mister Bit? Wer kennt sich und den Nächsten. Lassen wir es beruhen! Wir müssen einander die Weile ertragen. Wollen nicht von Vergeistigung schwatzen. Wollen den alltäglichen Dingen abgewinnen, was uns die Langeweile verkürzt. Sie nicken mir zu. Uns! bekräftigen Sie. Uns! Ob auch andern, soll uns Mausespeck sein.
Whisky? Ganz recht, Mister Bit, er dämpft das feine Empfinden. Und was auch immer, ein guter Tee ist besser als jedes sonstige Stimulans, und das beste ist und bleibt ein treffliches Wasser. Dennoch, nicht wahr? Zum Wohl denn!
Hoppla! Ihr Glas! Es tänzelt wie so manches, das an uns vorbeiglitt und uns verheißungsvoll gelächelt. Wir hielten es, es war unsere Freude, wir hielten es für unser ein und alles, und es wehte davon wie eine Flocke Gischt, indes das große Orchester der Welt weiterspielte, ungerührt wie die See.
Da fällt mir Kapitän Menck ein, Freund meines Urgroßvaters Justus Toppendrall. Er war zugleich Eigner einer stattlichen Brigg, Großvater hatte ihm die Galione geschnitzt, eine Löwin mit dem hübschen Gesicht von Käptns Braut. Die nämlich hatte eine Löwin gewünscht, er aber das Abbild seiner Felissa. So hatten sie sich auf eine Mischung geeinigt. Die Hochzeitsfeier fand statt auf dem fertig bei den Kajen liegenden Segler.
Felissa war aus gutem Pöseldorfer Hause und hoch musikalisch und für jene Tage ungewöhnlich abenteuerdurstig, sonst wäre sie Jonny Menck wohl kaum gefolgt. Und wollte auch die Jungfernreise seiner Brigg Felissa mitmachen.
Menck, ihr zu gefallen, sorgte auch für ein Instrument. Ein Klavier wäre zu sperrig gewesen in der kleinen Messe. Aber er trieb ein zierliches altes Spinett auf, was damals aus der Mode war und billig, ließ es herrichten und an Bord schaffen.
Um mit seiner Erwählten gehörig tanzen zu können, sah er sich nach einem Tastenkenner um und entdeckte einen solchen bald in einer der Hafenkneipen, einen schmächtigen jungen Menschen mit schlicht herabhängendem, blondem Haar, der dort den Matrosenverkehr mit Gassenhauern für »twee Dollar un duhn« bereicherte und nebenbei seine Schularbeiten zu erledigen schien. Er war noch fast ein Knabe, noch nicht fünfzehn und hatte statt der Noten ein Buch vor sich liegen, bißchen Goethe oder so was, spielte also alles Gewünschte so nebenher und auswendig. Dabei auch manches, was niemand bislang je gehört hatte und das wohl aus der Phantasie stammte.
Dieser tüchtige Jüngling, Sohn eines Hornisten bei der Bürgergarde und Baßgeigers beim Operntheater, wurde nun für Mencks Hochzeitsrummel herbeigezogen und stellte die Geduld der Gäste anfangs höchst eigensinnig auf Kohlen, indem er das Spinett erst mal genau stimmte, bevor er mit der Polonaise begann und zu jedermanns Beifall spielte.
Doch die Messe erwies sich rasch zu eng, zumal für den Walzer, und so wurde das Instrument auf Deck getragen. Der Musikant half bereitwillig mit, dann aber betrachtete er kritisch seine Hände, bewegte sie wie auffliegende Tauben und erklärte, er könne nicht sofort weiterspielen. So denn füllte die bräutliche Schöne die Pause. Es fand sich auch gleich eine ältliche Verwandte für einen Gesangsvortrag. Und es erklang das Lied »Wenn ich ein Vöglein wär und auch zwei Flügel hätt’/flög ich zu dir ...«
Die alte brave Dame sang gern, aber nicht gut. Dem jungen Musiker schmerzten die empfindsamen Ohren. Er flüsterte meinem Großvater zu, der neben ihm auf der Reling saß: Wenn ich ein Kater wär und auch vier Tatzen hätt’, schlich ich zu ihr.
In jenen Tagen war der Hafen noch von keinem Motor und Schneidbrenner und Preßbohrer durchtobt, und die Abende pflegten noch Arbeitsruhe zu kennen. Somit war sogar ein zartes Spinett, vorm Großmast aufgestellt, zum Tanz vernehmlich genug. Der junge Virtuose war auch bald wieder dabei, das Beste herauszuholen an Polka, Schottischem, Hornpipe und Green Sleeves und was alles damals in Mode stand. Zwischendurch flocht er – wie gesagt – Eigenes hinein, ohne daß es auffiel. Er hieß übrigens Johannes Brahms, wohnhaft in der Speckstraße beim Bäckerbreitengang. Heute steht da der Wolkenkratzer eines Margarinekonzerns, nachdem eure Bomben, Mister Bit, die Gegend in Schutt gelegt. Pietät? sagen Sie. Oh, so etwas ist selten, im Kriege wie in Hamburg.
Meinem Großvater, der zu Hause manchmal Flöte blies, war immerhin eines im Gedächtnis geblieben, und ich weiß noch, wie er das Motiv zur Unterstreichung seines Berichtes herzuzaubern versuchte, dieses dodade de dideida ... Es ist aus Opus 119; soviel ich weiß, das zweite Stück; es ist eins seiner rührendsten Einfälle, diese kleine Melodie, ein Stück Westwind mit aller Süße, Wehmut und Sehnsucht. Er kannte die See nur aus den Schnacks und Aufschneidereien, aus dem Seemannsgarn der Tavernen, und das mag ihn früh und gründlich bewahrt haben, seine Seele verledern zu lassen – wie es dem Feinfühligen bei dem härtesten aller Gewerbe, der Seefahrt, wohl geschehen kann.
Aber wir an der Wasserkante sind nun mal nicht frei von der Anfälligkeit, nach dem Glück und dem Unheil der Ferne uns zu verzehren. Er ging gen Ost denn auch davon, sozusagen rückwärts, mit dem Blick zur See. Aber trotz späterem Vollbart mit Zigarre spürt man doch in all seiner Schöpfung dieses sonderbare Ziehen und Säuseln aus West, den ungesättigten Horizont, die unbehauste Dünung, den grauen, spärlich durchsonnten Heimathimmel.
Sie sollten mal eine Reise mitmachen, junger Mann, mal die Nächte im Passat erleben, hatte damals Kapitän Menck gesagt, als er ihm drei blanke Taler Honorar zahlte: Kost und Logis frei, wenn Sie meiner Frau ein bißchen Noten umblättern und mal vierhändig oder wie und sonst hier und da mit anfassen, wie es so hinkömmt ...
Aber der junge Johannes hatte abgelehnt. Er hat ja auch nicht mal die Einladungen zu euch angenommen, Mister Bit, wie sein Landsmann Mendelssohn. Es ging ihm ja auch gut auf dem lieben Festland. Wollen zum Beispiel der Schweiz dankbar sein, wo er in Zürich und Winterthur sein Deutsches Requiem sorglos hat fertig vertonen können, betreut vom Verleger Rieter. Wer wohl in seiner Vaterstadt wäre auf solche Idee gekommen? Man hat ihm ja nicht mal – sogar zweimal nicht – den freigewordenen hiesigen Dirigentenposten gegönnt. Er war eben nicht weit genug her. Erst der dickste Weltruhm mußte ihm bescheinigen, daß ein geborener Hanseat auch etwas Rechtes mit den Musen zu tun haben könne.
Brahms ward hier geboren
und ging uns verloren
und starb in Wien.
Aber dennoch sind wir mächtig stolz auf ihn.
Das gibt es auch bei Ihnen, Mister Bit? Na ja, Cromwell war unmusikalisch. Und Händel und Haydn waren als Ausländer so geschätzt wie gewissermaßen bei uns Rolf Liebermann, der unsere Staatsoper leitete, aus der Schweiz stammt und nach Paris ging.
Johann Sebastian Bach aber ließen wir entgleiten, obwohl er geblieben wäre. An der Wasserkante sagt man übrigens auch so, wenn einer bei der Seefahrt umkommt. Händel hatte es sowieso nicht lange ausgehalten, wohl aber der Magdeburger Telemann. Und warum? Er hatte nicht nur ein breiteres Sitzfleisch, sondern viel inneren Humor und ein dickes Fell. Damit kommt in Hamburg selbst ein Künstler nicht unter die Räder und überzeugt sogar Senatoren, Oberalte nebst allhier geborenen Ehehälften.
Читать дальше