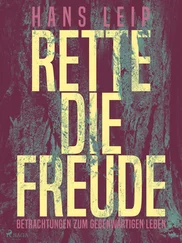Hans Leip
Die getreue Windsbraut
Saga
Ein süß und salzig gemischtes,
durchweg heiteres Buch
teils windiger, teils bräutlicher Geschichten,
mitgeteilt aus der Tafelrunde
„Zum Fröhlichen Haifisch“
zwischen dem Ärmelkanal und
der Biskaya in sieben Abenden
Kam ein Gast um Mitternacht,
Setzt sich an den Tisch,
Hat dem Nachbarn zugelacht
Und bestellt ihm frisch;
Ist nicht laut und ist nicht stumm,
Rutscht die ganze Reih’ herum,
Weder frech noch eingeschnappt.
Jeder hat ihn lieb gehabt. –
Und wie hieß der Wundersame? –
Freundschaft ist sein Name.
So laßt uns gute Segler sein
Bei Weltenwind und Sonnenwein
Und gute Trinker bis zum Tod!
Auf der Mel d’Iry-Insel zwischen dem Ärmelkanal und der Spanischen Bucht steht nahe dem Hafen Ovrail auf halber Höhe der Felsen ein Wirtshaus. Es heißt zum Fröhlichen Haifisch. Der Wirt ist ein untersetzter, ungewöhnlich breitschultriger, olivhäutiger Mann mit kleinen Augen, die bald den Spitzen stählerner Frittbohrer, bald denen gemütlicher Korkenzieher gleichen, je nachdem er einen Gast oder eine Flasche betrachtet. Sein schwarzes Haar ist geölt, sein Schnurrbart dagegen struppig wie ein Hofbesen, seine Hände haben die Form von Kartoffelschaufeln, aber dennoch sind seine Bewegungen zart, wenn er eine scharfe Sache unter der Tonbank hervorzieht und sie in die bläulichen Schnapsgläser träufelt. Er betreibt letzteres als eigentliches Geschäft, wenigstens der Öffentlichkeit gegenüber, bekümmert sich auch gelegentlich um den gottgesegneten Gemüsebau hinterm Haus, zumal den hübschen Stangenkohl, fährt auch hin und wieder mit auf Fischfang, wenn die Festlandspreise genügend hoch stehen, hat auch Neigung für gestrandete Schiffe, Wrackholz und dergleichen. Aber unter der Hand – und was hätte nicht Platz unter dieser Hand! – treibt er sicherlich ein wenig Schmuggel mit allerlei netten Sachen, die man in Paris ohne Zoll höher bewertet als mit, abgesehen davon, daß manche von abseitigen Kennern begehrten Genüsse selbst mit aller Offenherzigkeit gegen die grünen Nachkommen des Jüngers Matthäus schwer, wenn nicht unmöglich in den fetten Kreislauf des Geldes zu bringen sind.
Der Zollbeamte kannte ihn ganz genau, den Wirt zum Fröhlichen Haifisch, aber die beiden hatten nach anfänglicher unfruchtbarer Aufregung Frieden geschlossen. Eigentlich seit dem Abend, da der Wirt, er hieß Jean Poujell, vor den Augen des schnüffelnden damals noch jungen Zöllners einer soeben gefangenen und lebendigen Ratte den Kopf abbiß und ihn zum offenen Fenster hinausspie.
„So beiße ich!“ lachte Poujell dem Erbleichten ins Gesicht und entblößte seine Oberzähne, und diese bestanden, ein sonderbares Spiel der Natur, aus einer wohlausgebildeten Doppelreihe.
Das Schenkenschild führte seinen Namen also nicht mit Unrecht; manch biederer Maat von den bei schlecht Wetter im Hafen Schutz suchenden Küstenschiffen oder auch größeren, die vor der Biskaya Angst bekommen hatten, spürte es nachdem an seinen leergeschluckten Taschen. Jedoch auch bezüglich der Fröhlichkeit stimmte es; denn Jean Poujell pfiff und sang, obschon gänzlich heiser und daneben, den ganzen lichten Tag. Nur in der Dämmerung schwieg er und überließ den Gästen das Wort.
Er hatte übrigens eine Tochter, namens Virgitte, mit einem feinen weißen Madonnengesicht. Unglücklicherweise war sie bucklig. Sie litt darunter wie eine Heilige; denn der Alte hatte die Gewohnheit, sie vor aller Mäuler damit zu necken, wohl um eine abgründige Liebe sowie seine Enttäuschung und seinen Jammer wegen dieses Kindes in sich zu ohrfeigen, das merkte man. Seine Frau war längst tot. Aber Poujell wußte sich in der Nachbarschaft und wo es ging, dafür zu entschädigen.
Eines Tages lief in das kleine felsige Hafenloch ein deutscher Dampfer ein, der Seeschaden gelitten hatte und vernünftiges Wasser abwarten wollte. Es war kein besonders großes Schiff und hatte Stückgut nach Lissabon, Cadix und Barcelona und auch einige Passagiere, die teils nach spanischen Orten, teils ins Mittelmeer wollten. Es war zwischen Pfingsten und Weihnachten, also die richtige Reisezeit, ja, es war schon herbstlich, und einige der Fahrgäste hatten sicherlich dem trüben Wetter daheim gen Süden entfliehen wollen.
Leider nun war es auf dieser unfreiwilligen Zufluchtsinsel durchaus nicht paradiesisch, und man pries sich schließlich glücklich, in der Wirtsstube zum Fröhlichen Haifisch eine einigermaßen behagliche Bleibe zu finden. Denn auf dem Dampfer war es wegen des Ausbesserungslärmes, der mit eigenen Kräften begonnen worden war und in Eile bis spät nachts nicht schwieg, kaum erträglich.
Somit kamen die paar Fahrgäste, acht an der Zahl, samt und sonders zumindest an den Abenden, die schon früh und recht kühl hereindunkelten, in der gemütlichen Schenkstube zusammen. Es war dort im Hintergrunde ein abgeteilter, ein paar Spannen erhöhter Winkelplatz mit einem alten wackligen, runden Eichentisch, an dem schon mancher Fausthieb und manche Messerschneide gewetzt waren. Dorthin setzten sich auf Einladung des Wirtes die fremden Gäste, und von der Schiffsleitung kamen je nach der Wache entweder der Kapitän selber oder der erste und der zweite Offizier und oft auch einer der Maschinisten.
Die Bewohner der Insel sprachen bretonisch. Der Wirt allerdings verstand sich auf ein bißchen Englisch, Französisch und Spanisch, wie es zum Geschäft gehört, so daß man sich verständigen konnte.
Eine schiefe Klampfe hing dort an der Wand neben dem blau und goldenen Bild der heiligen Katharina, ein paar verrosteten Säbeln, Flinten und Seitengewehren aus den finstersten Zeiten der Bretagne, und unter der verrußten Decke baumelte ein ausgestopfter Schwertfisch und auch ein Hai, ein richtiger Blauhai mit grinsend gefletschtem Zahnkranz und von den Bröseln der Gäste gänzlich schwarz geräuchert.
Die deutschen Passagiere nun waren folgende: Um mit den Damen zu beginnen waren da nur zwei, nämlich erstens ein Fräulein Irene Siebenstern, vormals Kindergärtnerin, mit schauspielerischen Neigungen, die aber zu keinem bedeutenden Erfolge geführt hatten, weshalb auf Grund einer kleinen Erbschaft das hübsche, noch junge, sammetäugige Fräulein – sie war, kann man sagen, vielleicht ein wenig rundlich – ihre Lebensenttäuschung mit einem südlichen Seereisebummel zuzudecken unternommen hatte. Ihre Absicht war, die mangelnden Fähigkeiten, aber mehr wohl ihre mangelnde Reife durch eine Horizonterweiterung und durch fremdländische Abenteuer zu fördern. Sie hatte Zeit und begrüßte die Unterbrechung, da sie sich auf See noch nicht recht einzugewöhnen wußte. Sie, die an Bord ziemlich bläßlich umhergehangen hatte, blühte nun erstaunlich auf und wußte alle mit ihrer guten Stimmung anzustecken.
Dann war da noch die Gattin des Herrn Doktor Kosel, der halb auf eigene Rechnung, halb als Schiffsarzt mitgefahren war. Sie war wie ihr Mann sehr auf äußere Haltung aus, hatte blondere Haare als ihr womöglich von Natur zustanden, war überaus schlank, auch ein bißchen größer als er und verzog darum gewöhnlich die Schultern nach vorn, um lässig vornehm und kleiner zu erscheinen. Sie sprach nicht viel und immer mit einem leicht ausländischen Tonfall, was von entfernten englischen Verwandten herrühren mochte. Wer sie näher kennenlernte, fand, daß sie ganz verträglich war und mit Geschick viele ganz unmoderne kleine Häkelarbeiten anfertigte. Ihr Gatte war ein gemütvoller Vierziger, der den ganzen Tag auf der Insel in den Felsen und zwischen den Kohlalleen nach Pflanzen und Käfern jagte, das heißt, immer in betont gutem Anstande, aber nicht viel Beute heimbrachte, was an der Insel liegen mochte oder an seiner zu wenig dem wahren naturforschenden Umherkriechen und auf dem Baucherutschen zugewandten Figur oder auch daran, daß Fräulein Siebenstern ebenfalls durch das Eiland streifte, um den dunkelhaarigen Eingeborenen näherzukommen. Seine Frau saß währenddes am Strande oder an Bord und las oder häkelte.
Читать дальше