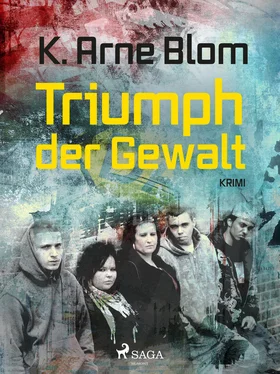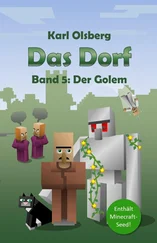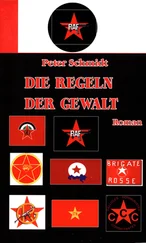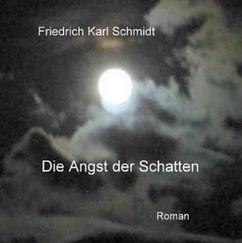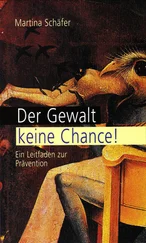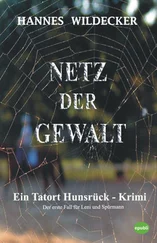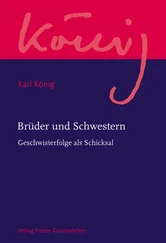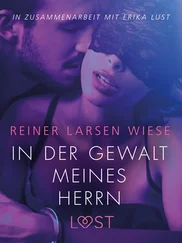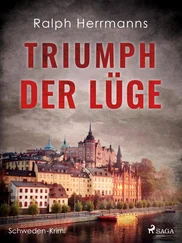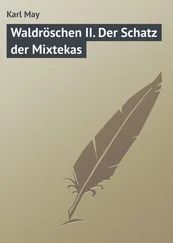Schließlich schlief Pettersson auf seinem Stuhl ein.
Magnus war das Ergebnis dieses Abends.
Die Pflegeeltern wollten, daß Magnus es gut hatte und seinen düsteren Erinnerungen entwuchs. Sie meinten es gut, aber für Magnus war es bereits zu spät. Nach seiner Meinung waren seine Pflegeeltern an seiner Lage schuld.
In der Schule wurde er gehänselt, weil er klein und schwächlich war und nicht in normalen Verhältnissen aufwuchs.
Zu Hause sprach er nie davon, daß er von seinen Schulkameraden verspottet wurde. Aber als er sieben Tage hintereinander mit Leidensmiene, blutverschmiert und abgerissen nach Hause kam, beschlossen seine Pflegeeltern, ihn um jeden Preis zum Reden zu bringen.
Schließlich kam es heraus. Doch nachdem Magnus berichtet hatte, schämte er sich, daß er sich das Geständnis hatte entlocken lassen. Und er schämte sich seiner Kleinheit.
Der Pflegevater setzte sich am selben Abend hin und schrieb dem Rektor einen Brief.
In dem Brief beschwerte er sich über die Mißhandlungen und teilte dem Rektor mit, was Magnus berichtet hatte.
Die Schulkameraden zerrten ihn in die Toilette und zwangen ihn, zu rauchen. Wenn er ihnen nicht gehorchte, verprügelten sie ihn.
Magnus bekam regelmäßig Taschengeld. Die andern Kinder nahmen es ihm weg. Wenn er es nicht freiwillig hergab, bedrohten sie ihn mit Taschenmessern, mit denen sie wütend vor seinem Gesicht herumfuchtelten.
Nach der Turnstunde ergötzten sich die Buben daran, ihm mit dem Handtuch einen Peitschenschlag nach dem andern ans Bein zu versetzen. Beim Schwimmunterricht hielten sie seinen Kopf unters Wasser, einmal so lange, daß ihm schwarz vor den Augen wurde.
Im Grunde fürchtete sich Magnus, zur Schule zu gehen. Trotzdem hatte er nie geschwänzt.
Der Rektor sorgte dafür, daß der Schulinspektor diesen Brief nicht zu sehen bekam, und rief Magnus zu sich.
Er fragte ihn, was für einen Unsinn er da seinen Pflegeeltern erzählt habe. „Willst du wirklich behaupten, daß derartige Dummheiten in meiner Schule vorkommen?“ fuhr er den Jungen an.
Darauf erzwangen die Pflegeeltern ein Gespräch mit dem Rektor, dem Klassenlehrer, dem Schulpsychologen und dem Berufsberater.
Die Sache kam der Presse zu Ohren – auf welche Weise, erfuhr man nie.
„Nach der Unterredung erklärten die Pflegeeltern, sich nicht mit den Maßregeln zufriedenzugeben, die die Schule treffen wird“, sagte der Rektor einige Tage später in einem Zeitungsinterview. „In jeder Schule besteht eine gewisse Neigung zu Pöbeleien. Wir tun, was wir können, sie beizeiten aufzudecken und einen Riegel vorzuschieben. Unter anderm werden die Schüler in der Pause auf dem Hof stets beaufsichtigt. Ich bin aber leider überzeugt, daß wir nur einen geringen Teil der Pöbeleien verhindern können. Es ist unmöglich, die heutige Verrohung von der Schule fernzuhalten. Dahin hat die Entwicklung leider geführt.“
„Meinen Sie damit, Herr Rektor, daß es früher derartige Vorfälle nicht gegeben hat?“
„Das habe ich nicht gesagt.“
Natürlich wurde daraus kein Fall für die Polizei.
Im übrigen war 1970, im ganzen betrachtet, ein recht gutes und angenehmes Jahr in Lund. Das neunhunderfünfzigste Jubiläum der Stadt wurde auf alle mögliche Weise gefeiert. Magnus Petterssons erste Berührung mit der Polizei sollte sich erst viel später in seinem Leben ergeben.
Das Jahr 1971 zeichnete sich durch einen Sommer aus, der als „der heiße Sommer“ in die Geschichte Schonens einging.
Die Sonne brannte auf die fruchtbare Erde und auf die Menschen, die guten und die schlechten.
Wer konnte, flüchtete aus der Steinwüste der Stadt, als die Hitzewelle ihren Höhepunkt erreichte. Es war tatsächlich so, daß man den Turm der Domkirche im Wärmedunst zittern zu sehen glaubte.
Die Abende waren lang, hell und schön.
Die Anlagen waren dichtbelaubt und spendeten wohltuenden Schatten.
Viele verliebten sich in diesem Sommer, und an einem heißen Augustabend liebte ein junger Mann sein Mädchen im Stehen am Tor des Ostfriedhofs.
Eine ältere Dame, die ihren Hund ausführte, wurde bei diesem Anblick vom Schlag getroffen.
Inger Elwing wurde in diesem Sommer, genauer gesagt, am 3. August, fünfzehn Jahre alt.
Am 22. Juli verbrachte sie den Abend bei ihrer Freundin Kerstin Johansson.
Die beiden Mädchen ließen Schallplatten laufen und rauchten am offenen Fenster.
Kerstins Eltern waren an diesem Abend ausgegangen. Kerstin hatte ein Flasche Rotwein aus dem Keller geholt, und sie hoffte, daß ihr Vater das Fehlen der Flasche nicht merken würde. Die Mädchen tranken ausgiebig.
Um Viertel vor neun verließ Inger das Mietshaus in der Brunnenstraße, wo Kerstin wohnte. Sie ging zu Fuß zum Botulfplatz. Von dort wollte sie mit dem Bus nach Nordfäladen heimfahren. Nordfäladen ist ein Viertel mit Mietskasernen im Norden der Stadt.
Der Botulfplatz ist die Endhaltestelle des Autobusses. Dort liegt auch die große Markthalle, die in den Jahren 1907/08 von der Stadt erbaut worden ist. Sie besteht aus roten Ziegelsteinen und sieht viel älter aus, als sie in Wirklichkeit ist.
Inger fühlte sich etwas unsicher auf den Beinen und kicherte immerzu vor sich hin. Der Wein tat seine Wirkung.
Im Sommer verkehren die städtischen Autobusse in Lund nur spärlich.
Inger sah den Bus, den sie hatte nehmen wollen, gerade abfahren, als sie den Botulfplatz erreichte.
Der nächste ging erst in vierzig Minuten.
„Scheiße“, sagte sie laut, als sie das feststellte.
Da sie keine Lust hatte, so lange zu warten, beschloß sie, ein Stück zu Fuß zu gehen. Den Rest des Weges wollte sie dann fahren.
Vom Wein benebelt, ging sie aufs Geratewohl los.
Sie hätte die nördliche Richtung einschlagen müssen, zum Marktplatz, an der Domkirche vorbei, über die Breitestraße und am Krankenhaus vorbei.
Aber aus irgendeinem unersichtlichen Grund schwenkte sie bei Gleerups Buchhandlung ab und nahm Kurs gen Westen, zum Grand Hotel und zum Bahnhofsplatz.
Erst beim Bahnhofsplatz merkte sie, daß sie die verkehrte Richtung eingeschlagen hatte.
Ihre Schwipsstimmung war von Müdigkeit abgelöst worden, von schlechtem Befinden und Schwindelgefühl. Sie ging im Schneckentempo und hatte die größte Lust, sich in die Gosse zu legen und zu schlafen.
Krampfhaft bemühte sie sich, die Richtung auszumachen, obwohl die Umgebung doppelte Konturen zu haben schien. Sie ging am Bahnhof vorbei zum Clemensplatz.
Als sie beim Clemensplatz anlangte, überwältigte die Müdigkeit sie so sehr, daß sie mitten auf dem Platz beim Brunnen auf eine Bank sank. Ihr war sehr übel.
Plötzlich erbrach sie sich, sie konnte gerade noch den Kopf abwenden, so daß ihr Kleid nichts abbekam.
Sie wußte nicht, was sie tun oder wohin sie gehen sollte. In diesem Augenblick gewahrte er sie.
Er hieß Rolf Jönsson und war siebenundvierzig Jahre alt.
Er ging auf sie zu.
„Ist dir nicht gut?“
Inger rülpste als Antwort.
Er erbot sich, sie zu sich nach Hause mitzunehmen, damit sie durch eine Tasse Kaffee wieder nüchtern wurde.
Sie kam willenlos mit.
Rolf Jönsson hatte ganz in der Nähe, in der Spolestraße, eine Zweizimmerwohnung mit Küche.
Er ließ sie auf einem Sofa Platz nehmen; dann begab er sich in die Küche, um den Kaffee zu kochen.
Sie saßen nebeneinander auf dem Sofa und tranken Kaffee. Sie sahen sich den Fernsehfilm an. Aber nach einer Weile wurde Inger so müde, daß sie einnickte.
Auch Jönsson war nicht ganz nüchtern; doch er war es gewohnt, Alkohol zu sich zu nehmen.
Inger hatte zum erstenmal in ihrem Leben Wein getrunken. Er stieß sie an. „Du, Inger, streck dich auf dem Sofa aus. Ich hole dir etwas zum Zudecken.“
„Mmmmm“, murmelte sie und streckte sich aus.
Читать дальше