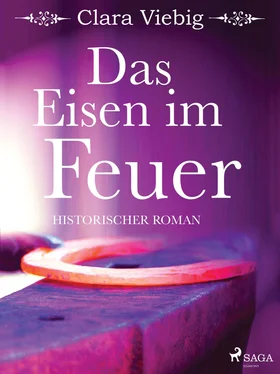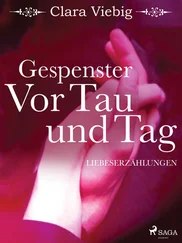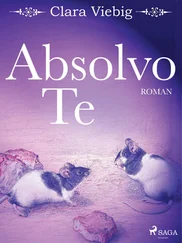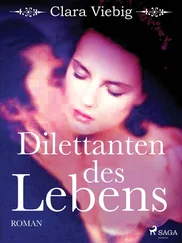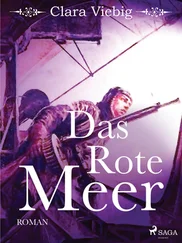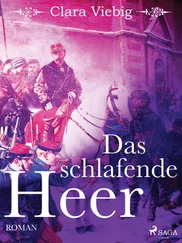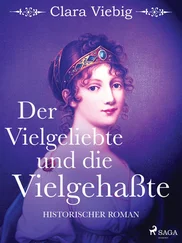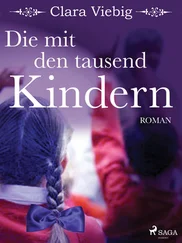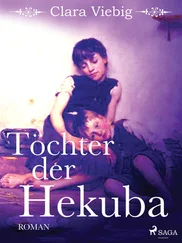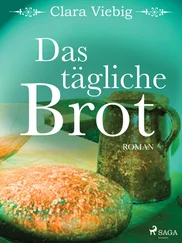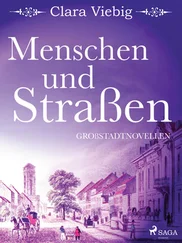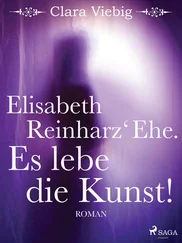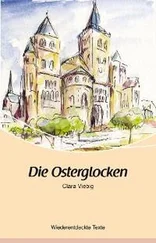Ein paarmal schon war Hermann Henze mit seinem Meister aneinandergeraten, und mit einem Nebengesellen hatte er Streit gehabt. Es war sonst nicht seine Art, zu zanken, jetzt aber war er oft gereizt. Es kränkte ihn zu sehr, dass er die Minne nicht kriegen sollte. Warum entzogen sie ihm das Mädchen? Das Haus konnten sie ihm nicht verbieten, dafür hatten sie eben Gastwirtschaft, aber er wurde schlecht behandelt, von allen Gästen am wenigsten gut bedient, wenn das August Lehmann auch leugnete. Er fühlte es ja: die wollten ihn nicht. Und er ballte die Fäuste.
Die Stille hielt er nicht mehr aus, diese Lahmheit, die in den Wintertagen kroch, die so früh dämmerten, so lange Abende hatten, an denen man nicht wusste, was man anfangen sollte, an denen man an seinen Nägeln kauen konnte und warten. Warten als einzige Beschäftigung. Der Schlosser hatte früher diese Stille nie drückend empfunden; andere Winter waren eben anders gewesen, da hatte er gepfiffen, gesungen, war hübschen Mädchen nachgestiegen — vielleicht auch hässlichen, bei Nacht sind alle Katzen grau — jetzt hatte er dazu keine Lust. Er wunderte sich selber darüber. Immer sah er die kleine Minne vor sich; so wie die, war doch keine andere. Aber sie versteckte sich vor ihm. Und wenn er sie einmal erwischt hatte, dann war’s nur ein flüchtiges Blicken, ein verstohlenes Augenzuwinken, ein Nicken, ein Lächeln — kein herzhafter Kuss. Einrennen hätte er das Haus in der Schützenstrasse mögen, sich die Kleine herausholen trotz Zetergeschrei und Mordio. Er gewöhnte sich jetzt das Wirtshaussitzen an: was sollte er denn sonst machen?! —
Und wie Henze erging es noch vielen; es lastete eine drückende Stille auf diesem Winter, es lag ein Verlangen in der Luft der Zeit. Man sehnte sich nach dem Frühling; aber nicht nach jenem Frühling, der an Baum und Busch neues Grün zeitigt und die Veilchen blühen lässt — ein anderer Frühling musste kommen. Mit Brausen musste er die alte Welt erfüllen, aufrütteln, Umstürzen, eine neue Welt erstehen lassen, in der man ledig war der ärgerlichen Bevormundung und der Versprechungen landesväterlicher Huld.
Schwache Hoffnungen waren einstmals aufgegrünt, aber sie waren bald abgefallen wie Keime an krankem Baum.
Der König, dem man entgegengejubelt hatte bei seinem Regierungsantritt, der als König hatte der erste Bürger sein wollen, der an die Stelle des schweigenden Vaters als redender Sohn getreten war, der statt des gewohnten, nüchternen Verstandes Geist zu bieten schien, Schwung und Begeisterung, der eine Amnestie erliess für jene, die in den Festungen sassen — dieser König war doch nicht der Reiter, den der Renner braucht, der Morgenluft und Freiheit wittert.
Einen König, zu dem man wie zu Gott beten, aber von dem man nichts zu fordern haben sollte, der nur aus Gnaden gewähren wollte und alles selbst und ganz alleine schaffen wie Gott Vater, diesen König verstand sein Volk nicht. Und man war der mittelalterlichen Maskeraden, der Rede-Akte, der Huldigungsfeierlichkeiten müde.
Die, die es verstanden, erklärten es denen, die es nicht verstanden, was die Rede des Königs zu bedeuten hatte, die er gehalten hatte bei der Eröffnung des vereinigten Landtags.
«Ich werde es nun und nimmer zugeben, dass sich zwischen Mich und dieses Land ein beschriebenes Blatt eindrängt. »
Das hiess einfach: ‚Eine Verfassung kriegt ihr nicht. Ich regiere, ihr habt stille zu sein.
Leute, die sich bis dahin herzlich wenig um Politik gekümmert, die um nichts anderes gesorgt hatten als ums tägliche Brot, waren jetzt die Allerinteressiertesten. In den Weissbierstuben, wo sonst ruhige Spiessbürger verkehrten, denen es ans Leben gegangen wäre, hätten sie nicht zur bestimmten Stunde, auf dem bestimmten Platz ihre Weisse trinken und dann friedlich heim zu Muttern gehen können, sassen jetzt erregte, gekränkte, aus ihrer Ruhe aufgestöberte Männer.
Also der ehrsame Bürger, der immer pünktlich seine Steuern gezahlt, dem König gegeben, was des Königs ist, und Gott, was Gottes ist, der sollte ein freches Spiel mit dem Christentum getrieben, die Religion missbraucht haben zu einem Mittel des Umsturzes?! «Nanu! »Herr Krause, der alle Sonntag zur Kirche ging mit seiner Gattin in dem Schal aus Persien, war empört. «Weil wir nicht ’ran wollten an die Ieschichte mit dem Bistum in Jerusalem, darum! Da schlag doch einer lang hin. Wozu solln wir denn Jottes Wort aus Jerusalem kriejen durch jeweihte Bischöfe? Det können wir hier bequemer haben. Und überhaupt —! »
«Na, und denn das mit dem Heiligen Rock, »fiel ihm Herr Pieseke in die Rede und fingerte nervös an seinen Vatermördern, die nicht modisch hoch, sondern behaglich schlapp über die schwarze Halsbinde heraushingen, «ist so was erhört in unserm aufjeklärten Jahrhundert?! Nie und nimmer hätte ich zujejeben, dass sie den ausstellen — ich, Jottlieb Pieseke! »
Selbst Herr Rosentreter und der Kammergerichtsaktuarius äusserten Unwillen: wofür war man denn Berliner und helle, man hatte auch ein Selbstbewusstsein, man brauchte sich nicht vorschreiben zu lassen, was und wie man denken sollte.
Und in den Destillen der Königstadt, in den Kellerkneipen, wo der Arbeiter und Nante Strumpf sich einen hinter die Binde giessen, war jetzt eine Unruhe, ein bewegtes Durcheinander, wie bei dem Kampf vor Bäckertüren. Was hatte Er gesagt?
«Mein Volk will gar nicht das Mitregieren von Repräsentanten. Der Vollgewalt seiner Könige allein verdankt es seine Freiheit, seinen Wohlstand. »
Schöner Wohlstand das! War es einem je so erbärmlich gegangen wie jetzt? Wenn man auch arbeiten wollte, war denn Arbeit zu kriegen? Für alles war Geld da, nur für den armen Mann nicht. Man wollte gar keine Volksvertretung, sagte er? Hatte der eine Ahnung! Natürlich wollte man. Nur einer, der selber aus dem Volke ist, weiss, was das gebraucht. Und war kein solcher da, der für das Volk redete, oho, so würde das selber laut und vernehmlich-fordernd schreien!
Wie ein Strom, der über die Ufer tritt und die Dämme durchbricht, so breitete der Volksunwille sich aus.
Auch Hermann Henze wurde von diesem Unwillen mit fortgerissen. Ganz recht hatten sie, der Arme war zu übel daran: das Mädchen, das er liebt, kriegt er nicht, ewig Geselle bleiben muss er auch, nie wird er Meister! Er murrte.
Aber der Student, Richard John, der bei denselben Leuten, bei denen Henze in Schlafstelle lag, das Vorderzimmer bewohnte, belehrte ihn: es kam nicht auf das Schicksal des einzelnen an. Auf das Volk als Ganzes, auf das Preussen, das sich in den Freiheitskriegen durch sein vergossenes Blut das Anrecht auf die Freiheit erworben hatte, die ihm jetzt so elend verkümmert wurde. «Pressfreiheit, Redefreiheit, freies Versammlungsrecht, das wollen wir! »Der hübsche Junge glühte. «Verstehen Sie das, Henze? Die Zensur ist ein unwürdiger Zustand für uns! »
Der Schmied nickte. Er bewunderte den Studenten, weil er fühlte, dass der hatte, was ihm selber abging: Bildung.
«Und dann gleiche politische Berechtigung aller, ohne Unterschied der Religion und des Besitzes! »
Donnerwetter noch mal, ja, so musste es sein! Der Arbeiter schlug mit harter Faust auf den Tisch. Das verstand er vollkommen: gleiche Berechtigung ohne Unterschied des Besitzes. Er lachte dröhnend: das müsste schön sein! In Hermanns Seele kam es wie ein Jubel, seine Augen lachten mit.
Aber der Student blieb ernsthaft. «Amnestie für alle politischen und Pressvergehen, Geschworenengerichte, Unabhängigkeit der Richter, Verminderung des stehenden Heeres, Volksbewaffnung, allgemeine deutsche Volksvertretung — ach, lieber Henze, wir haben so viel zu wünschen! »Seufzend stützte der Student den Kopf in die, wie bei einem Mädchen wohlgepflegte und schmale Hand.
«’n bisschen viel is et ja! »Der Schmied nickte, und dann betrachtete er nachdenklich seine beiden groben Fäuste: ohne die würde es wohl nicht abgehen. Gewichtig legte er dem andern die Hand auf die Schulter: «Hören Sie, Herr Student, wenn’s losgeht, denn sagen Se mir man Bescheid! »—
Читать дальше