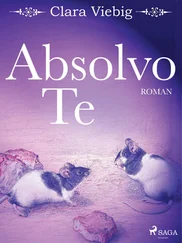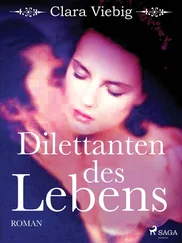Jugendstreiche — wie lagen die so weit! Mit fünfzehn Jahren hatte ihn die Mutter nach Berlin in die Lehre gebracht; nun war er schon über zwölf Jahre in der Grossstadt. Es gefiel ihm gut hier, aber in die Schwemme hätte er doch einmal wieder reiten mögen, so wie ihn Gott geschaffen, und aufjuchzen hätte er dabei mögen, aufjuchzen. Was die Mutter wohl machen mochte?! Lange, sehr lange hatte er nicht an sie gedacht. Wenn man so weit von der Heimat fort ist, verliert man die Fühlung mit ihr und mit denen, die noch dort wohnen; Berlin wird einem Heimat. Aber an die Alte schreiben musste er nun doch einmal, seit mehr als einem Jahre hatte er nichts von ihr gehört. Lebte sie noch? I, wo würde sie nicht! Wenn sie tot wäre oder es ihr schlecht ginge, hätte er schon von ihr zu hören gekriegt! Er schüttelte die Erinnerung ab: wozu sich erinnern? Das war zu nichts nütze. Lieber an der Zukunft bauen, die gehörte ihm.
Er fing an zu pfeifen. Hell schrillte das durch die Strasse. Gleich würde der Nachtwächter auf seiner Runde kommen, ihm’s Pfeifen verbieten — wurde einem denn nicht alles verboten? Nächtliche Ruhestörung, mit nach der Wache in der Lindenstrasse oder nach der Stadtvogtei. Der sollte sich unterstehen! In den Rinnstein flog er mitsamt seiner Laterne, seinem Spiess und seinem Horn — ein Überbleibsel aus alter Zeit. Jetzt wurde aufgeräumt mit den Überbleibseln, mit all den Zöpfen von Anno dazumal; Berlin mauserte sich, schon morgen wurde es Weltstadt! Herausfordernd klang das Pfeifen des jungen Mannes. Einen mächtigen Schatten warf seine breite Gestalt.
Hermann Henze war wieder besserer Laune geworden. Die Luft der Strasse, die am Tage matt gewesen war und verbraucht, durchdünstek von allerlei Menschengerüchen und Staub und Rauch, war jetzt frischer. Vom runden Loch des Platzes herunter kam ein freierer Luftzug, ein Odem der Felder jenseits der Stadtmauer. Die waren ja noch nicht allzu weit; schimmernd von Tau, schlangen sie einen Gürtel noch rund um die ganze Stadt: Äcker, Wiesen, Sandhügel, auf denen Windmühlen sich drehten, Kiefern-, Akazienwäldchen, Schafgraben, die Panke, und die den Ausgüssen der Stadt entronnene, ihre Arme wieder vereinigende, breitflutende Spree.
Mit geblähten Nüstern, wie ein Renner, der Freiheit wittert, stand der Schlosser. Wohin jetzt? Die meisten Kneipen waren schon geschlossen. Aber dahin stand ihm auch nicht die Lust — nach was denn?!
Seine Sinne stürmten. Er hatte das Mädchen nicht zu sehen bekommen, das er liebte, Minnes Hand nicht gefühlt, ihr den Kuss nicht geraubt, nach dem es ihn drängte. Den vollen Mund aufgeworfen in Trotz und Begier, stand er zögernd; ihn grauste vor dem einsamen Bett. Wohin jetzt, wohin?! Unschlüssig stand er noch — weiss Gott, er konnte jetzt noch nicht nach Hause gehen — so nicht — das Blut klopfte in ihm, schon wollte er einbiegen in die Krausenstrasse, dem finsteren Plätzchen der Böhmischen Kirche zu, da streifte ein Mädchen an ihm vorbei, sah ihm scharf ins Gesicht, blieb dann stehen und lachte sich eins.
Das war die Luise — Minnes Freundin! Erfreut fasste er nach ihrem Arm: die liess er jetzt nicht.
Sie war atemlos; sie hatte der Mutter etwas nachbringen müssen, das die vergessen hatte, als sie eilends geholt wurde zu einer Frau.
«Komm ’n bisschen! »Er hielt ihren Arm fest.
«Jerne. Mutter is nich da — die andern kümmern sich nich um mich. »
Er wollte, er musste von Minne sprechen, dieses Mädchen kannte sie genau.
Und Luise hing sich willig an seinen Arm. Ihr vom Laufen erhitztes Gesicht wurde ganz blass, ein Glück schoss ihr zum Herzen: er, er führte sie! Und mitunter drückte er ihren Arm wie mit Zärtlichkeit fester an sich. Luise wusste ganz genau, ihr galt das nicht — aber warum es nicht auskosten, das Glück der Stunde?! Sie presste die Augen zu: ‚jetzt wenigstens gilt es mir‘. Schmiegsam passte sie ihren Schritt seinem grossen an. Immer von Minne reden, immer von Minne; dass er’s nur nicht müde wurde, dies Spazierengehen!
Sie erzählte ihm von der Freundin, als die noch klein gewesen war. Niedlich und immer lieb! Sie hatten zusammen auf der Strasse Triesel geschlagen, und Minneken hatte geweint, wenn er in den Rinnstein gesprungen war, Luise hatte ihn ihr mit den Fingern herausgelangt. Sie hatten auch Brückmänneken gespielt auf den Rinnsteinbrücken, und Schleichhexe und Räuber und Prinzessin mit anderen Kindern, aber Minne war immer ein bisschen bange gewesen. Und sie hatte sich so gefürchtet vor dem Neunaugenmann, der abends, wenn es schummerte, die Strasse hinunterschrie: ‚Neunoogen! Neun-oo-ogen!‘ Es klang schaurig, dumpf und hohl. Da hatte Minne sich immer verkrochen; man brauchte nur zu sagen: ‚der Mann mit den neun Oogen kommt‘, und husch war sie weg.
Luise lachte leise, sie hatte sich hineingezwungen in diese Erzählung, nun ward sie doch selbst davon übermannt. Ihre Stimme klang weich. Erinnerung nach Erinnerung tauchte ihr auf; es war ja auch alles noch nicht so lange her, sie hatte es nur vergessen gehabt beim Kinderwickeln und Windelnwaschen und bei all dem, was ihr Leben so hässlich machte. Fast mit Tränen der Rührung sprach sie von Minnes Güte. Die hatte so manchesmal ihre Stullen mit ihr geteilt, den letzten Happen, die war überhaupt so gut, so gut und so sanft, ein Engel war die!
Luise berauschte sich an den eigenen Worten; es klang so schön, was sie sprach. Wenn’s sich auch nicht alles ganz so verhielt, wie sie sagte, jetzt schien es ihr doch so. Und jetzt fühlte sie es nicht, dass sie sich selber einen Dornenkranz aufsetzte mit ihren Lobpreisungen.
Der Mann lauschte entzückt. Er hätte das Mädchen an seinem Arm schier zerdrücken mögen vor lauter Wonne. Das entzückte ihn am meisten, dass die kleine Minne sich so gefürchtet hatte vorm Neunaugenmann — die würde sich überhaupt vorm Manne fürchten, die Zarte, die Schwache! Ihn, den Starken, bezauberte das.
Sie gingen immer kreuz und quer, bogen bald in die Strasse ein, bald in jene. Lauter dunkle Strassen, in denen es jetzt so einsam war, wie im dichtesten Wald. Luise hielt die Augen geschlossen, willenlos liess sie sich führen, sie wollte nichts sehen. Sie redete nur; ihr Mund sprach wie von selber, es floss ihr von den Lippen, es war ein Glück, so sprechen zu können. Ach, immer so weiter, immer so weiter wie im Traum — wenn der doch nie zu Ende sein möchte! Sie litt es, dass des Mannes Arm sich um ihre Taille stahl.
Es war eine milde Nacht, eine Nacht, wie im Frühjahr, nein, wie im Sommer. Es war noch Hitze darin. Sie fühlten beide eine Glut.
Der Mond war untergegangen, sie tappten über einen dunklen Platz. Da waren Büsche, sie traten auf Rasen — da stand eine Bank, und sie setzten sich.
In dunklen Umrissen ragte das Palais des Prinzen am Wilhelmsplatz vor ihnen, die Schildwache ging auf und ab, man hörte nichts als deren gleichmässigen Tritt.
Duftete nicht Flieder, blühten nicht die hohen Büsche übervoll. süss, ganz berauschend?! Luise schmiegte sich enger an ihren Begleiter, er suchte ihren Mund. Er atmete hastig: warum denn nicht, war sie denn nicht ein Mädel? Ein ganz nettes Mädchen, ein ganz molliges Mädchen? Er drückte ihr einen Kuss nach dem andern auf.
Luise sprach nicht mehr, seine Küsse brannten sie; sie konnte auf einmal nichts mehr von Minne reden, sie wusste auf einmal nichts mehr von der, nicht ein einziges Wort. In ihrer Brust hob sich etwas, das beengte sie: ein Gefühl übergrosser Sehnsucht, ein Gefühl zärtlichen Verlangens, mit Mühe nur hielt sie an sich. Sie zitterte, sie schwieg.
Da sagte er: «Du erzählst ja gar nischt mehr? Nu weiter! »
«Ich weiss nischt mehr. »
Er stand plötzlich auf: «Na, denn gehn wir nach Haus! »Er liess den Arm, mit dem er sie fest umschlungen hatte, von ihr. Sie blieb noch einen Augenblick sitzen, wie erstarrt; dann stand auch sie auf.
Читать дальше