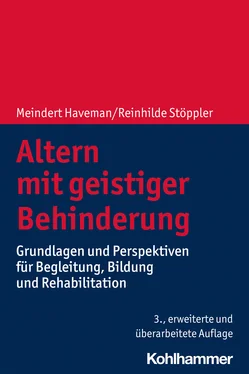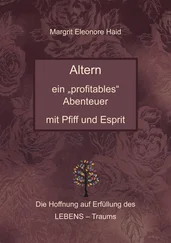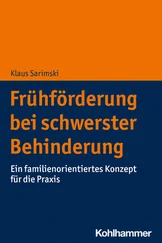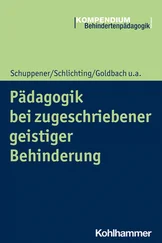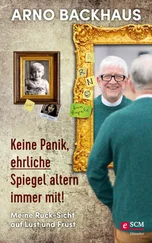4.3.7 Institutionalisierungseffekte
Andere Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung wurden nach dem Zweiten Weltkrieg durch das Fehlen von Alternativen in psychiatrischen Kliniken oder Einrichtungen für geistig Behinderte aufgenommen. Stärker noch als in Deutschland waren in den Niederlanden religiöse Orden und Glaubensrichtungen für die Begleitung und Pflege verantwortlich. Klijn (1995) untersuchte die Lebensgeschichten von geistig behinderten Bewohnern in der Periode 1879 bis 1952 zweier großer katholischer Einrichtungen im Süden der Niederlande, nämlich St. Anna (Frauen) und St. Joseph (Männer) im Dorf Heel (Limburg). Durch eine sorgfältige Studie der noch vorhandenen Dokumente individueller Lebensgeschichten, schildert sie das Alltagsleben und strukturelle wie auch kulturelle Bedingungen. Obwohl es einschneidende Unterschiede im historischen Vergleich zwischen den beiden Ländern Deutschland und Niederlande gibt (z. B. die systematische Vernichtung der Menschen in der Periode 1939–1945 in Deutschland), zeigen sich in der Organisationsentwicklung sehr viele Parallelen. Auch in Deutschland war die Periode nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Gratwanderung des Versorgungssystems für Menschen mit geistiger Behinderung zwischen Caritas und Psychiatrie beeinflusst. Strukturelle und kulturelle Charakteristika dieser Umwelt beeinflussten Wertvorstellungen, Lebensstil, Lebensanschauung, Interessen wie Desinteressen und das Verhalten vieler Menschen in der Jugend und im Erwachsenenalter, wodurch nun das Leben älterer Menschen mit geistiger Behinderung geprägt ist.
Viele Werte und Strukturen der Begleitung in Einrichtungen sind durch die in dieser Zeit und in dieser Gesellschaft dominanten Ideologien zu erklären. Das Klassensystem und der Unterschied zwischen arm und reich äußerten sich als soziale Klassen-Abteilungen auch innerhalb dieser Einrichtung. Ein harter Arbeitstag (Brot nach Arbeit) und eine strenge Erziehung im Glauben waren wichtige Prinzipien in dieser Zeit.
Einige der genannten Aspekte erinnern auch an das Konzept der »Totalen Institution« (Goffman, 1961). Eines der Wesensmerkmale einer totalen Institution ist, dass die Möglichkeit, an verschiedenen Orten zu schlafen, zu arbeiten und sich zu erholen, aufgehoben ist. Alles findet am selben Ort unter der Verantwortlichkeit derselben Autorität statt.
»Darüber hinaus läuft jeder Abschnitt des Tagesablaufes ihrer Mitglieder in der unmittelbaren Gegenwart einer großen Zahl anderer ab, die alle in der gleichen Weise behandelt werden und alles untereinander tun müssen. Schließlich ist der Tagesablauf genau eingeteilt, wobei die eine Tätigkeit zu einer festgesetzten Zeit von der nächsten abgelöst wird und die ganze Folge des Handelns durch ein System expliziter formaler Regeln von einer Gruppe von Funktionären von oben her bestimmt wird« (ebd., S. 24).
Die Kluft zwischen der kontrollierten Gruppe (Insassen) und dem Aufsichtspersonal war groß. Die Insassen lebten hauptsächlich sozial isoliert hinter Mauern. Langjährige Bloßstellung von Menschen durch solche Systeme – ohne die Möglichkeit zu haben, alternative Lebenswelten kennenzulernen – prägte den Menschen. Bertling & Schwab (1995) beschreiben einige Konsequenzen.
»Heute noch erzählen alte Bewohner und Ordensschwestern vom früheren Alltagsleben in den Einrichtungen, von der Arbeit im Garten, in der Landwirtschaft, vom gegenseitigen Helfen in den großen Gruppen. Das war eine Notwendigkeit, weil über viele Jahre ausschließlich wenige Ordensleute die Pflege der behinderten Menschen übernahmen. Mithilfe, feste Regeln für Alltage und Festtage bestimmten den Tagesablauf und Jahreslauf. Sie boten Orientierung und festen Halt im Leben. Wenn wir genau hinschauen, können wir bei unseren alten Bewohnern heute noch das Orientieren und Festhalten an bestimmte Regeln beobachten« (ebd., S. 216).
Viele ältere Menschen mit geistiger Behinderung wurden als Kinder in diese Einrichtungen aufgenommen, wurden verwahrt und gepflegt, aber nicht gefördert, weil sie aufgrund ihrer Behinderung als »bildungsunfähig« galten. In ihren Entwicklungschancen ist diese Gruppe von Menschen kaum zu vergleichen mit den Geburtskohorten der letzten 30 Jahre, die vorschulisch, schulisch, im Arbeitsbereich und der Erwachsenenbildung gefördert wurden.
Auch Menschen mit geistiger Behinderung in höherem Alter haben plastische und adaptive Fähigkeiten, um sich veränderten Umständen anzupassen. Es ist jedoch grundsätzlich zu erwarten, dass viele dieser Menschen durch Lücken in der Förderung, Verwahrlosung von Fähigkeiten und durch Ausschluss von der Öffentlichkeit Periodeneffekte zeigen.
4.3.8 Aktives Altern für Menschen mit geistiger Behinderung
Über die Gültigkeit und Wirksamkeit des Konzeptes »Aktives Altern« gibt es wenig Forschung. »Aktives Alterns« ist ein wichtiges Thema der Forschung in Australien (Bigby et al., 2004). So wird dort die Notwendigkeit gesehen, das Tempo und die passive Teilnahme an der Tagesunterstützung im Alter von Menschen und die formalen programmatischen Anforderungen zu ändern. Seltzer und Krauss (1987) untersuchten in den USA die Tagesprogramme von älteren Menschen in den USA und stellten fest, dass viele Programme gezielt nur Optionen für Personen anbieten, die ein langsameres Tempo und geringere Arbeitstage beinhalteten. Bigby et al. (2004) meinen, dass dies ein begrenztes Verständnis der Institutionen und Mitarbeiter widergibt. Stattdessen sollte man Menschen mit geistiger Behinderung anregen und fördern, um ein gesundes und aktives Altern zu leben, bei dem die Aufrechterhaltung von Fähigkeiten, die Entwicklung von Interessen und sinnvolle Freizeit- und Arbeitsrollen im Vordergrund stehen.
Andere Studien (z. B. Buys et al., 2008) untersuchten die Perspektiven alternder Menschen mit geistiger Behinderung und konzentrierten sich auf Themen wie das Erhalten von Fähigkeiten, das aktive Einbeziehen in gesamtgesellschaftliche Aktivitäten und das Erhalten von Lernmöglichkeiten.
Buys et al. (2008) stellten fest, dass ältere Erwachsene mit geistiger Behinderung mehr Entscheidungsbefugnis in Bezug auf ihr eigenes Leben wünschen. In der Lage zu sein, ihre täglichen Aktivitäten zu wählen und dass diese produktiv sind und zur Gemeinschaft beitragen, sind wichtige Komponenten für ihre Lebensqualität. Die Fortsetzung der »Teilnahme an produktiven Aktivitäten nach eigenem Ermessen« ist ein wesentlicher Bestandteil des erfolgreichen Alterns (Bigby, 2002). Wenn Menschen mit geistiger Behinderung selbst über ihre Sicht auf das Älterwerden befragt werden, stellen sie sich eine schlechtere Gesundheit, mehr Probleme mit bestimmten Fähigkeiten oder Aktivitäten, die Beendigung der Arbeit und Veränderungen im sozialen Leben als Merkmale des Alters fest (Erickson et al., 1989). Studien, in denen danach gefragt wurde, was ihnen wichtig ist, wenn sie älter werden, zeigen, dass sie sozial aktiv bleiben möchten, auch wenn sie älter werden und aufhören mit der Arbeit und Tagesaktivitäten (Mahon & Mactavish, 2000; Bigby, 1997). Menschen möchten auch an dem Ort alt werden, an dem sie schon immer gelebt haben oder wo sie Menschen kennen. Ihr soziales Netzwerk ist klein und es ist wichtig, den Bekannten und Freunden nahe zu sein (Shaw et al., 2011; Bigby, 2008). Richter et al. (2010) stellten fest, dass alternde Erwachsene mit geistiger Behinderung sich über aktive Tage freuten, sie sich jedoch besonders freuten, wenn ihre Aktivitäten einen Zweck hatten und sie das Gefühl hatten, etwas zur Gesellschaft beizutragen.
Einer der wichtigsten Bestandteile einer sinnvollen täglichen Aktivität für alternde Erwachsene mit geistiger Behinderung ist der soziale Aspekt. Menschen mit geistiger Behinderung haben in der Regel kleinere soziale Netzwerke als Menschen ohne Behinderung (Lippold & Burns, 2009). Informelle, unbezahlte Gemeinschaftsbeziehungen sind häufig aufgrund von Kommunikationseinschränkungen, physischer Isolation von der Gemeinschaft insgesamt oder von Fehlwahrnehmungen anderer Personen nicht verfügbar (Crawford, 2004). Daher ist es für Mitarbeiter und andere Begleiter wichtig, die Aufrechterhaltung und das Wachstum von Freundschaftsnetzwerken zu fördern (Hogg et al., 2000). Die Teilnahme an Aktivitäten und Veranstaltungen wie an religiösen Versammlungen, soziale Freizeitgruppen (Tanz, Kunst, Singen), Konzerte, Erwachsenenbildung usw.) und bezahlter Beschäftigung trägt zum Ausbau der begrenzten sozialen Netzwerke alternder Erwachsener mit geistiger Behinderung bei (Buys et al., 2008; Judge et al., 2010) und verringert die soziale Isolation.
Читать дальше