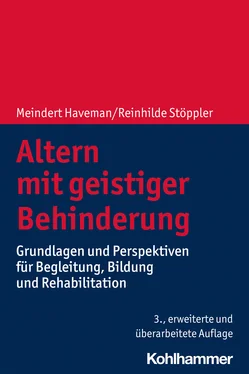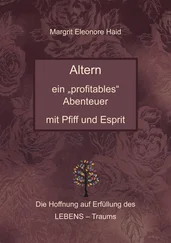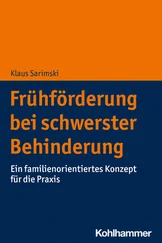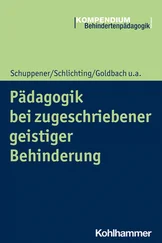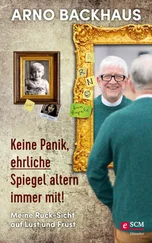Die Resultate der Generali Altersstudie 2013 unterstützen teilweise die Annahmen der Aktivitätstheorie: 45 % der 65- bis 85-Jährigen engagieren sich bürgerschaftlich in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen (z. B. in Kirche, Freizeit und Geselligkeit, Sport und Bewegung, Kultur und Musik, sozialer Bereich) und können sich sogar vorstellen, dieses Engagement noch weiter zu steigern. Sie unterstreichen damit die Auffassung, dass Ältere noch eine Mitverantwortung für gesellschaftliche Entwicklungen und Lebensbedingungen tragen möchten (vgl. Köcher & Bruttel, 2012, S. 341). Die Autoren fanden heraus, dass das jeweilige Engagement eng mit der gesundheitlichen Situation der Person zusammenhängt: Je gesünder die älteren Menschen sind, desto aktiver ist ihr Engagement (vgl. Köcher & Brüttel, 2012, S. 350). »Die Bedeutung der eigenen gesundheitlichen Konstitution als Schlüsselfaktor für ein aktives Leben und die gesellschaftliche Teilhabe« (ebd., S. 350) spielt also eine entscheidende Rolle.
Die Aktivitätstheorie, die Aktivität als relevanten Garant für zufriedenes und erfolgreiches Altern einschätzt, ist für Menschen mit geistiger Behinderung jedoch eher kritisch zu betrachten. Ältere Menschen mit geistiger Behinderung stellen noch weniger eine homogene Gruppe dar als Gleichaltrige in der Gesamtgesellschaft. Durch erlernte Hilflosigkeit, kognitive, psychische und emotionale Probleme hat nicht jeder in dieser Zielgruppe die Möglichkeit und den Willen, durch Aktivitäten den Alterungsprozess zu verlangsamen. Bedingt durch ihre Lebens- und Wohnsituation und Beeinträchtigungen sind sie oftmals nicht in der Lage, die Phase des Alters aktiv und ohne ein erhebliches Maß an fremder Hilfe zu gestalten. Auch mit der Unterstützung anderer Personen ist die von dieser Theorie geforderte Aktivität nicht immer erreichbar.
4.3.2 Loslösungstheorie (Disengagementtheorie)
Die Loslösungstheorie wurde Anfang der 1960er Jahre von Cumming und Henry (1961) nach dem struktur-funktionalistischen Modell Talcot Parsons entwickelt. Basierend auf dem Defizitmodell des Alters wird Loslösung als Voraussetzung für erfolgreiches Altern angesehen, wobei der Verlust von Kontakten und Aktivitäten positiv zu sehen ist. Es versucht die Mikroebene des persönlichen Erlebens und Verhaltens im Alter mit gesellschaftlichen Aspekten zu verknüpfen (Wahl & Heyl, 2004, S. 130). Loslösung (Disengagement) entsteht aufgrund gesellschaftlicher und auch individueller Interessen; der Rückzug erscheint als unvermeidbarer Prozess, in dem Beziehungen gelöst und verändert werden. Altern wird als biologischer und nicht korrigierbarer, hinzunehmender Prozess gesehen, der zur Verminderung von geistigen, körperlichen und seelischen Kräften führt. Diese Verminderungen führen zu einem sozialen Rückzug aus unterschiedlichen Lebensbereichen, der von der Gesellschaft erwartet und durch den Einsatz jüngerer Menschen kompensiert wird. Loslösung wird auch als Bedürfnis älterer Menschen betrachtet, der gewünscht und als Ruhe- und Selbstentfaltungsbedürfnis akzeptiert wird.
Die Loslösungstheorie (Cumming & Henry, 1961) geht also davon aus, dass mit zunehmendem Alter ein gegenseitiger Rückzug eintritt: Die Person zieht sich aus der Gesellschaft zurück und die Gesellschaft zieht sich von der Person zurück. Der Ruhestand wird als ein Beispiel für die Loslösungstheorie gesehen. Die Art des Ausscheidens aus dem sozialen Bezugssystem der Arbeitswelt ist hierbei von zentraler Bedeutung. Ausgangspunkt der Loslösungstheorie ist eine von der betroffenen Person ungewollte Berentung, die mit der vermeintlichen, mit dem Alter sinkenden Leistungsstärke und Handlungsfähigkeit begründet wird (vgl. Backes & Clemens, 2013, S. 128). Diese Sichtweise unterscheidet sich deutlich von der Perspektive der Aktivitätstheorie. So schreiben Backes und Clemens (2013): »Das Aktivitätskonzept unterliegt zumindest in seinen Annahmen nicht den Stereotypisierungen von Alter als einem Abbau von Fähigkeiten und reduziertem Bedürfnis nach Betätigungen, sondern weist darauf hin, dass solche reduzierten Aktivitäten und Interessen oft erst durch gesellschaftlich herabgesetzte Möglichkeiten entstehen« (Backes & Clemens, 2013, S. 130).
Die Loslösungstheorie ist heute nicht weit verbreitet und hat im Laufe der Jahre viel Kritik erhalten. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Menschen von der Arbeit zurückziehen und ihre Interaktion mit der Gesellschaft verringern möchten, was nicht immer der Fall ist (Cumming, 1963). Ein Hauptkritikpunkt an der Loslösungstheorie ist die Betrachtung des Ruhestandes als »bloße Restzeit« (Kohli, 1994, S. 236) des Lebens. Die Tatsache, dass die Menschen mit oder ohne Behinderungen immer älter werden und die Lebenserwartung steigt, hat die Lebensphase des Ruhestandes einen weitaus größeren quantitativen und qualitativen Stellenwert für die Menschen gegeben. Die »Wartezeit« ist zu lang, um diese Periode auf eine Wartezeit auf den Tod zu reduzieren (vgl. Kohli, 1994, 236). Ebenfalls kritisch zu betrachten bleibt die Annahme, dass der Rückzug und das Disengagement einen natürlichen Prozess darstellen, auf den die alten bzw. alternden Menschen zielführend hinarbeiten.
Bei der Bewertung dieses Ansatzes für die Zielgruppe der älteren Menschen mit geistiger Behinderung ist zunächst die angebliche Übereinstimmung von individuellen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Erwartungen kritisch zu bewerten (vgl. Wahl & Heyl, 2004, S. 122). Menschen mit geistiger Behinderung erfahren in der Regel lebenslang Ausgrenzungen aus dem gesellschaftlichen Leben. Für diesen Personenkreis ist es kaum möglich, sich den Erwartungen und dem Druck zu widersetzen. Reduktion des sozialen Netzwerkes ist für niemanden wünschenswert, da soziale Kontakte von existentieller Wichtigkeit sind.
4.3.3 Kontinuitätshypothese
Eine ausschließliche Generalisierung der beiden vorausgehenden Theorien ist wenig sinnvoll (Komp, 2006). Vielmehr müssen Faktoren wie Gesundheit, Fähigkeiten, Kompetenzen, Persönlichkeit, Umwelt und bisheriger Lebensstil berücksichtigt werden. So würde die erste Theorie einen Aktionismus geradezu herausfordern und nur den als zufriedenen Menschen ansehen, der über einen hohen Anteil an Aktivitäten und über zahlreiche Sozialkontakte verfügt. Bei der Betonung der Theorie des Rückzuges wäre nur der nach innen gekehrte Mensch zufrieden und würde somit die vielfältigen Angebote der Alten- und Behindertenhilfe in Frage stellen.
Die Kontinuitätstheorie kann inhaltlich als Synthese aus Aktivitäts- und Loslösungstheorie verstanden werden. Sie geht davon aus, dass weder nur Aktivität noch ausschließlich Rückzug bei der Bewältigung des Alterungsprozesses hilfreich sind, sondern die Möglichkeit, alte Interessen, Gewohnheiten und Aufgaben beizubehalten. Dabei sind Diskontinuitäten zwischen mittlerem und höherem Erwachsenenalter, verursacht z. B. durch den Tod von Angehörigen, Wohnortwechsel, nachlassenden Gesundheitszustand oder Reduktion des sozialen Netzwerkes, negativ zu bewerten. Die Kontinuitätstheorie geht davon aus, dass Menschen ihren früheren Lebensstil fortsetzen, wenn sie älter werden. Atchley (1999) berichtet, dass »die Kontinuitätstheorie sich mit der Konstruktion und Verwendung von Erhaltens-Mustern befasst, die dazu dienen, das Leben zu verbessern und sich an Veränderungen anzupassen« (ebd., S. 7). Menschen verlassen sich auf die Verwendung bekannter Denk- und Verhaltensmuster, wenn sie sich an Veränderungen anpassen, die mit dem Alter eintreten. Lebensumstände (z. B. mangelnde Finanzen, schlechte Gesundheit, Witwenschaft) können Menschen jedoch daran hindern, ihren vorherigen Lebensstil aufrechtzuerhalten.
Die Kontinuitätshypothese berücksichtigt zwar individuelle Differenzen des Aktivitätsgrades, Interessen und Gewohnheiten, sieht aber die Kontinuität im Lebenslauf als wichtigen Garanten für zufriedenes Altern an. In der starken Betonung der Vermeidung von Diskontinuitäten kann Kritik an der Theorie formuliert werden. Die angeführten Diskontinuitäten stehen in Abhängigkeit zu verschiedenen anderen Faktoren wie Einkommen, Gesundheitszustand, soziale Beziehungen und Freizeitgestaltung. Individuelle Problematiken werden in der Kontinuitätstheorie zwar erfasst, jedoch nicht in Verbindung mit sozial ungleichen und altersbedingten Lebensphasen gesetzt (vgl. Backes & Clemens, 2013, S. 138). Für Menschen mit geistiger Behinderung ist auch diese Theorie nicht hinreichend differenziert. Kontinuität im Lebenslauf ist für Menschen mit geistiger Behinderung kaum zu erreichen, da gerade ihre Lebensverläufe von ständigen Diskontinuitäten geprägt sind. Institutionelle Vorgänge, wie z. B. Berufsaustritt oder Wohnortwechsel, machen es dem alten Menschen mit geistiger Behinderung unmöglich, Kontinuität aufrechtzuerhalten.
Читать дальше