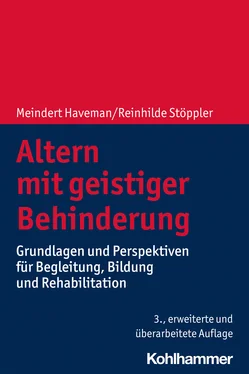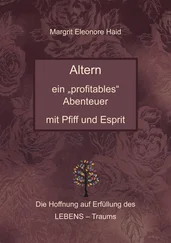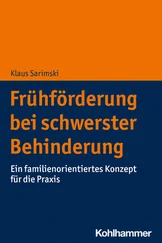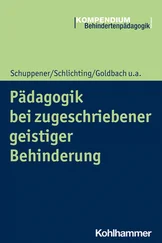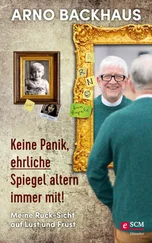In der sonderpädagogischen Arbeit hat die Lebensgeschichte eine doppelte Funktion (vgl. Bertling & Schwab, 1995). Auf der einen Seite geht es darum, den Menschen durch die Begegnung mit seiner Geschichte besser zu verstehen. Die andere Funktion ist, mit dem behinderten Menschen an dessen Lebensgeschichte zu arbeiten und sie voranzubringen. Beides ist schwierig – das Verstehen wie auch das »Daran-Denken«.
Der Lebenslauf und die erzählte Lebensgeschichte sind zwei verschiedene Aspekte. Erstere ist eine objektivierte chronologische Darstellung wichtiger und bedeutungsvoller Erfahrungen im eigenen Leben. Die Lebensgeschichte jedoch besteht aus einer mehr oder weniger geordneten Aufreihung von Geschehnissen und Erlebnissen, allerdings reduziert zu dem, woran wir uns noch erinnern. Es sind keine Videofilme, die früher aufgenommen und jetzt auf Abruf abgedreht werden, sondern Fragmente, die emotional gefärbt und durch spätere persönliche Erfahrungen mitgestaltet sind. Es wird immer ein Lebensgefühl im Alter geben, ein Basisgefühl im heutigen Erleben, das auf Vergangenem beruht, auch wenn die Vergangenheit dem Menschen nicht mehr bewusst ist. Für viele Menschen, auch für Menschen mit geistiger Behinderung, hat die Lebensgeschichte so viel Einfluss auf das Lebensgefühl, dass dadurch die Zukunftserwartungen und die Zukunftsperspektive bestimmt werden. Es ist diese persönliche Geschichte, die es verständlich machen kann, warum der eine Senior noch joggt und auf Festen sein Tanzbein schwingt, während ein Gleichaltriger nicht von seinem Stuhl loskommt, lieber allein ist und wenig Initiative zeigt. Es ist auch die individuelle Biografie, die erklären kann, warum einige ältere Menschen mit einer geistigen Behinderung eine Depression entwickeln und andere Menschen in derselben Situation nicht.
Nicht nur erbliche und konstitutionell bedingte Unterschiede in der körperlichen, motorischen, kognitiven, emotionalen und sensorischen Entwicklung, sondern auch wesentliche Unterschiede im Lebenslauf machen ältere Menschen mit geistiger Behinderung zu dem, was sie sind: Menschen mit einer großen Verschiedenheit in individuellen Merkmalen und Charakterzügen. Die Heterogenität und die Vielfalt der Unterschiede fallen auf. Es handelt sich keineswegs um eine homogene Gruppe, wie sie oft verstanden wird. Die Zuordnung zu einem bestimmten IQ-Bereich und statistische Mittelwerte verschleiern vielfältige Ausprägungen des Älterwerdens, die unendlich vielen Varianten, die aus der Biogenese, der früheren Entwicklung und dem Lebenslauf zu erklären sind (vgl. Lehr, 1980). Hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte, die zu erforschen ist; nicht nur um den Lebenslauf kennenzulernen, sondern auch um das Verhalten im Kontext der persönlichen Entwicklung und der sozialen Umstände erklären zu können. Nicht jeder Mensch ist sich des eigenen Lebenslaufs in derselben Weise bewusst. Auch gibt es verschiedene Stadien und Momente im Leben, in denen sich Menschen auf einer anderen Art und mit unterschiedlicher Intensität ihrer eigenen Lebensgeschichte bewusst sind.
Nach Timmers-Huigens (1995) ist die Lebensgeschichte und die Weise, mit der Menschen die Lebensgeschichte interpretieren, unter anderem abhängig von:
• der momentanen Situation;
• der Stimmung und Atmosphäre der Situation;
• der Länge der Lebensgeschichte;
• der »stressful life events«, der intensiv froh oder traurig erlebten Momente in der Lebensgeschichte;
• der Art, wie man gelernt hat, die Geschehnisse im Leben zu interpretieren und zu deuten.
Mit Letzterem ist gemeint: das Total der sinnlichen, kognitiven, emotionalen und sozialen Prozesse der Auseinandersetzung einer Person mit ihrer Welt beim unabschließbaren Versuch, den Erfahrungen einen Sinn abzuringen, der das Ganze zusammenhalten könnte. Dieses Vermögen des Menschen, nicht nur in guten, sondern auch in widrigen und aussichtslosen Umständen, Sinnhaftigkeit im eigenen Leben entdecken zu können, bezeichnet Antonovsky (1979; 1987) in seinem Salutogenese-Modell als »Sense of Coherence«.
Dieses »Deuten« und »Interpretieren« wird unter anderem geformt durch:
• die Kultur und Gesellschaft, in der man lebt;
• die Lebensphilosophie, den Glauben, die Lebensvision und das Lebensgefühl, mit dem man aufgewachsen ist;
• die Art und Weise, wie Mitmenschen (Vorbilder wie Eltern, Lehrer, Idole und andere wichtige Personen im eigenen Leben) mit wichtigen Lebensgeschehnissen umgehen;
• die Fähigkeit, sich an Geschehnisse zu erinnern (Gedächtnis);
• die Art, wie man in der Vergangenheit Geschehnisse erlebt und verarbeitet hat;
• die Hilfen und Stützen im sozialen Umfeld bei der Verarbeitung der Geschehnisse (Timmers-Huigen, 1995, S. 361f.).
Viele der heutigen alten Menschen mit geistiger Behinderung gingen nicht zur Schule, weil es bis in die 1960er Jahre keine Schulpflicht gab, und blieben bei den Eltern, bis diese sie wegen eigener Altersprobleme oder weil ein Partner starb, nicht mehr begleiten konnten. Andere wurden schon in sehr jungem Alter, manchmal schon als 2- bis 6-jährige Kinder, in Großeinrichtungen aufgenommen. Dies wurde den Eltern empfohlen oder die Eltern konnten oder wollten nicht mehr für die Pflege und Begleitung des Kindes aufkommen. Neben diesen Anstalten gab es in den 1950er Jahren kaum Alternativen.
Viele der heutigen älteren Menschen mit geistiger Behinderung haben Invalidität und gesundheitliche Schäden durch medizinische Unterversorgung erfahren und sich in psychiatrischen Kliniken, Pflegeheimen und Großwohneinrichtungen einer oft rigiden und unpersönlichen Erziehung und Verwahrung unterwerfen müssen. Das Leben in der Wohneinrichtung war oft ein schlechtes Abbild der Normen und Werte, die damals in der Gesellschaft vorherrschten, mit einer starken sozialen Stratifikation in soziale Klassen sowie Frauen- und Männer-Abteilungen. Auch waren die Kontaktmöglichkeiten durch den intramuralen Aufenthalt zur Gesellschaft draußen, nämlich zu Familie, Freunden, Bekannten und anderen, sehr reduziert. Man lebte ein separiertes, sozial isoliertes Leben, in dem Fremdbestimmung zur Tagesordnung gehörte.
Vor dem Zweiten Weltkrieg wurden in den damaligen Hilfsschulen Kinder aufgenommen, die wir heute als geistig- oder lernbehindert bezeichnen würden und von denen heute nur noch wenige leben. Aufgrund der großen Unterschiede in den Lernbeeinträchtigungen waren die Mitarbeiter der Hilfsschulen oftmals überfordert und konnten die Kinder nicht gezielt fördern (Speck, 1979). Man bevorzugte den leistungsorientierten Unterricht, wobei Schüler mit geistiger Behinderung zwangsläufig ins Hintertreffen gerieten und langsam zum »Ballast« wurden. Ab 1933 begann man damit, die Sammelklassen aufzulösen, sodass Schüler mit geistiger Behinderung verstärkt aus dem Schulwesen verdrängt wurden. Mit dem § 11 des Reichsschulpflichtgesetzes von 1938 schloss man diese Kinder schließlich als »bildungsunfähig« aus den staatlichen Schulen aus (vgl. Mühl, 1984; Speck, 1979).
Während des Nationalsozialismus war die Existenz von Menschen mit geistiger Behinderung nicht nur bedroht – systematisch wurde ihnen als »Ballastexistenzen« das Recht auf Leben abgesprochen. Auch nach dem Zusammenbruch des »Dritten Reiches« hatte der Krieg einschneidende und lang andauernde Konsequenzen. Die ersten Jahre nach Kriegsende waren geprägt durch die Folgen des Krieges: Der Wiederaufbau der zerstörten Städte, die Sicherung der eigenen Existenz und wirtschaftliche Interessen bestimmten in dieser schwierigen Zeit das Handeln und Denken der meisten Menschen (vgl. Craig, 1983). An Unterstützung sowie schulische Förderung von Kindern mit geistiger Behinderung, war in dieser Situation nicht zu denken.
Aber auch in den 1950er Jahren, der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs Deutschlands, erhielten Familien mit Kindern mit geistiger Behinderung keine staatliche Hilfe (vgl. Craig, 1983). Menschen mit geistiger Behinderung besaßen kein Anrecht auf Bildung und hatten somit auch keine Aussicht auf eine berufliche Ausbildung. Wie in den meisten Bundesländern, existierte auch in Rheinland-Pfalz weiterhin der § 11 des Reichsschulpflichtgesetzes vom 6. Juli 1938, der die »Schulbefreiung von geistig behinderten Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter« vorsah (vgl. Bach, 1979; Mühl, 1984). Ein Großteil der betroffenen Familien musste ihre behinderten Kinder zu Hause versorgen. Die meisten waren dadurch sehr großen Belastungen ausgesetzt. Eltern konnten lediglich versuchen, das Kind in einem Heim, beispielsweise der Diakonie oder der Caritas, unterzubringen. Jedoch reichten die hier vorhandenen Plätze bei Weitem nicht aus. Außerdem bedeutete die Heimunterbringung eine weitgehende Trennung vom Kind (vgl. Urban & Fröhlich, 2000, S. 17f.).
Читать дальше