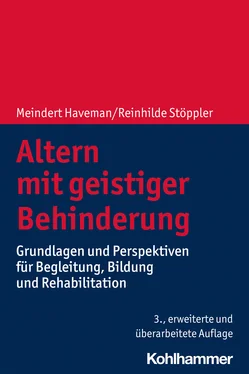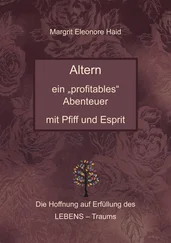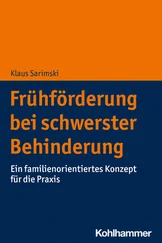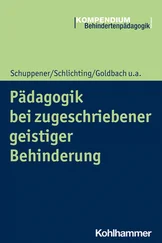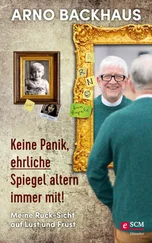Eine häufig beobachtbare psychische Veränderung im Alter ist die Zunahme von Stereotypien (ständiges Wiederholen von Äußerungen oder Bewegungsabläufen) bei der Bewältigung von Alltagssituationen. Diese wurde vor allem bei Menschen mit Down-Syndrom festgestellt (vgl. Eisenring, 1987; Haveman & Schrijnemaekers, 1995). Diese können u. a. durch eingeschränkte Coping-Möglichkeiten in Krisensituationen entstehen, die aus den häufig eingeschränkten »verbal-kognitiven Verarbeitungsmechanismen resultieren« (vgl. Weber, 1997). Auch das geringe Differenzierungsvermögen im affektiven Bereich führt zu einer erhöhten Anfälligkeit für psychische Auffälligkeiten.
In fast allen Studien werden bei Menschen mit geistiger Behinderung höhere Prävalenzraten von psychischen Störungen im Vergleich mit älteren Menschen in der Gesamtbevölkerung gefunden (Haveman, 1995; Chance, 2005). So fanden Patell et al. (1993) bei 8,6 % der älteren (50+) Menschen mit geistiger Behinderung in einer englischen Region psychische Störungen (vor allem Depression und Angststörung) und bei 11,4 % der Personen mit Demenzerkrankungen. Mit zunehmendem Alter (65+) werden in anderen Untersuchungen in Großbritannien bei Menschen mit geistiger Behinderung höhere Prävalenzraten (ca. 20 %) psychischer Störungen gefunden (Bland et al., 2003; Cooper 1999; Day & Jancar, 1994). Dabei geht es vor allem um Depressionen und Ängste.
Auch Day (1985) und James (1986) beschreiben viele Fälle von Depressionen und Angststörungen bei älteren Menschen mit geistiger Behinderung, die durch körperliche Krankheit, Verlust von Körperkraft und Mobilität sowie durch den Verlust eines Familienmitgliedes oder Freundes zu erklären sind.
Einige Studien, die sich auf psychiatrische Diagnosen bei älteren Menschen mit geistiger Behinderung richten, legen nahe, dass im Alter das Risiko für allgemeine psychiatrische Morbidität, Demenz, Angststörung und Depression etwas erhöht ist (Cooper, 1997a, b; Deb et al., 2001). Auch in einer groß angelegten Studie in Schweden (Axmon et al., 2017) hatten ältere Menschen mit geistiger Behinderung höhere Wahrscheinlichkeiten auf mindestens eine psychiatrische Diagnose als Gleichaltrige in der Allgemeinbevölkerung, die stationär oder ambulant behandelt wurden. Die größte Diskrepanz zwischen den beiden Kohorten bestand bei psychotischen Störungen. Im untersuchten Zeitraum (11 Jahre) kamen bei Menschen mit geistiger Behinderung zehnmal häufiger psychotische Störungen vor als bei der Allgemeinbevölkerung. Die einzige diagnostische Kategorie in der Allgemeinbevölkerung mit einer höheren Wahrscheinlichkeit waren Störungen im Zusammenhang mit Alkohol-/Drogenmissbrauch.
4.3 Soziologisches Altern
Die Soziologie setzt sich unter anderem mit der Frage nach sozialen Positionen von Menschen im Alter auseinander. Jedes Individuum nimmt im Laufe seines Lebens unterschiedliche Positionen ein. Diese werden erworben sowie zugeschrieben und von der Person selbst und seiner Umwelt zusammengefügt. Dazu gehören unter anderem beispielsweise eine Familien-, eine Berufs-, eine Alters- und Geschlechtsposition, mit der jeweils eine bestimmte Rolle verbunden ist. Die Rolle bestimmt die Erwartungen und Aufgaben, die an die jeweilige Position herangetragen werden (Skiba, 2006, S. 163).
Thomae (1968) geht davon aus, dass primär soziale Einflüsse den Alterungsprozess beeinflussen. Aus soziologischer Sicht ist der Aspekt der Geburtskohorte von großer Bedeutung. So ist die Generationszugehörigkeit für verschiedene Leistungen im Alter bedeutsamer als das chronologische Alter. Anzunehmen ist, dass z. B. Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Kriege, Ernährungsgewohnheiten, das jeweilige Gesundheits- und Erziehungssystem, Familienstrukturen, Krisen (wie die Corona-Parandemie) etc. den Kohorteneffekt beeinflussen (vgl. Filipp & Schmidt, 1995, S. 442). Aber auch Werte, Kulturinteressen, Musik und Kommunikationsmittel, mit der die neue Generation aufgewachsen ist, unterscheiden sich von der vorigen. Die »neuen Alten« sind aufgewachsen in einer Zeit der Liberalisierung und Individualisierung.
»Es beginnt sich eine immer größer werdende Personengruppe der älteren Menschen mit neuen Verhaltenseinstellungen zu entwickeln. Für sie gilt: ›Lebensqualität ist nicht das, was mir geboten wird, sondern das, was ich daraus mache. Infolge der Individualisierung wird die Eigenverantwortlichkeit betont‹ (Schramek, 2002, S. 57)« (Buchka, 2003, S. 117).
Religion und Altern ist ein weiteres wichtiges kultursoziologisches Thema. Nicht nur bei den Jüngeren, auch bei der älteren Generation kann eine wachsende Tendenz der Säkularisierung festgestellt werden. Für viele ältere Menschen hat die Religionszugehörigkeit jedoch noch immer eine große Bedeutung. Sie prägt das Erleben des Alterns und ist für viele Lebensbereiche relevant. So bekommt z. B. das chronologische Altern eine ganz andere Wertigkeit und Bedeutung, wenn Verlusterfahrungen (Sterben des Partners, eigene Krankheit) an ein Gottvertrauen und den Glauben an ein Leben nach dem Tod gekoppelt sind.
Es ist kaum bekannt, welche Konsequenzen das religiöse Altern oder das Fehlen des religiösen Alterns für Menschen mit geistiger Behinderung hat. Auch gibt es keine Daten, ob in dieser Hinsicht Unterschiede auf der Ost-West- (neue versus alte Bundesländer) oder Nord-Süd-Achse (evangelisch versus katholisch) bestehen. Die Bedeutung der Deinstitutionalisierung traditioneller Werte durch Reinstitutionalisierung ist ein relevantes Thema für die Gerontosoziologie, hat aber bis jetzt kaum das Interesse der sonderpädagogischen Soziologie geweckt.
Neben dem Rollenwechsel findet im Alter auch eine »Veränderung des Gewichts der verschiedenen Vergesellschaftsformen« statt (vgl. Kohli, 1994, S. 256). Durch den Eintritt in den Ruhestand verliert die Arbeit an Bedeutung; es kommt zu einer Verlagerung des Schwerpunkts hin zu anderen Vergesellschaftungsformen wie Familie, Verwandtschaft, Freizeit und sozialen Netzwerken außerhalb der Familie. Durch den o. a. Trend der Singularisierung steigt das Risiko, im Alter nicht mehr auf primäre soziale Beziehungen zurückgreifen zu können (vgl. Trost & Metzler, 1995, S. 23). Hierdurch gewinnen andere soziale Bindungen wie Vereine, Freunde etc. an Bedeutung.
Ein weiterer wichtiger Aspekt aus soziologischer Sicht stellt das Altersbild in der Gesellschaft dar, das überwiegend negativ behaftet ist, denn Altern wird als Zeit des Abbaus, des Abstiegs, des Verlustes gesehen. Dieser Prozess wird von Thomae (1988) mit dem Begriff des »Ageism« beschrieben, der die stigmatisierende systematische Vorurteilsbildung und Diskriminierung aufgrund des »Altseins« meint.
Weitere bedeutsame soziologische Aspekte sind die altersspezifischen Rollen mit ihren altersspezifischen Merkmalen. So spricht man nach Thieme (2008) von soziologischem oder sozialem Altern, »wenn es um den unterschiedlichen Grad der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben oder den Rückzug aus sozialen Rollen (z. B. der Erwerbstätigkeit) und gesellschaftlich geprägten Verhaltensmustern (z. B. nach dem Auszug der Kinder aus der gemeinsamen Wohnung) geht« (ebd., S. 34). Unter Zuhilfenahme des chronologischen Alters werden Rollenzuschreibungen und Erwartungen bestimmt. Alternde Menschen unterliegen oft Vorurteilen, z. B. beim Arbeitgeber. Abnahme der Arbeitsproduktivität, Verringerung des persönlichen Engagements im Arbeitsleben, um nur einige zu nennen, sind Befürchtungen der Arbeitgeber. Ergebnisse von empirischen Studien widerlegen diese Befürchtungen zumindest teilweise. Es zeigen sich lediglich Einbußen in der Produktivität (vgl. Backes 2003, S. 55). Dabei ist das Alter von Rollenverlusten gekennzeichnet; diese werden nicht nur von außen an das Individuum herangetragen, sondern alte Menschen haben auch selbst das Bedürfnis, sich von sozialen Rollen zurückzuziehen. Diese Aussage liegt der Disengagement-Theorie nach Cumming & Henry (1961) zugrunde. Demgegenüber geht die Aktivitätstheorie davon aus, dass alte Menschen weiterhin das Bedürfnis haben, aktiv zu bleiben und soziale Rollen auszufüllen, um eventuelle Verluste durch Berufsaufgabe zu kompensieren (vgl. Kohli, 1994, S. 235). Sicherlich haben beide Theorien ihre Berechtigung, gelten aber nicht in ihrer jeweiligen Absolutheit (vgl. von Rosenstiel, 1994, S. 241) und vor allem nicht bei Menschen mit geistiger Behinderung.
Читать дальше