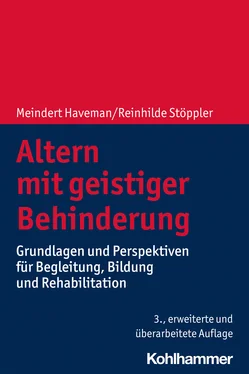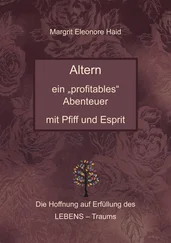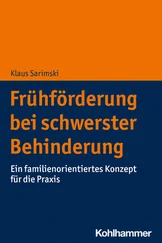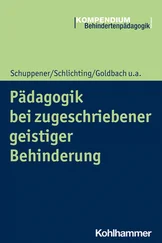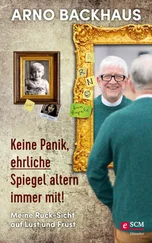Das Kompetenzmodell postuliert, dass Entwicklung über die gesamte Lebensspanne gleichzeitig die Aspekte Wachstum oder Gewinn und Abbau oder Verlust enthält. Baltes & Baltes (1990) entwickelten das Modell der »Selektiven Optimierung durch Kompensation«. Grundlage dieser Theorie ist die Annahme, dass die Funktionen und Wertigkeiten, die soziale Beziehungen im Lebenslauf einnehmen, Veränderungen unterworfen sind. Im Alter gewinnen emotionale Kontakte an Relevanz, im Jugendalter waren es vielmehr instrumentelle Kontakte. Eine Erweiterung der sozialen Kontakte ist im Alter nicht nötig, da der Verlust von sozialen Kontakten durch die emotionale Qualität bestehender Kontakte kompensiert werden kann. Alte Menschen streben in individuell spezifischen Kontakten eine Optimierung ihrer Handlungsmöglichkeiten und Erwerb bzw. Verbesserung von Kompetenzen an, mit Hilfe derer sie die Verluste, die sie in anderen Bereichen erleben, ausgleichen können.
Das Interesse an dieser Sichtweise ist in den letzten Jahren gestiegen, da nicht die Defizite des älteren Menschen im Mittelpunkt stehen, sondern die persönlichen Fähigkeiten und Ressourcen hervorgehoben werden. Der Ansatz öffnet den Blick auf die Bedingungen des erfolgreichen Alterns und schafft die Voraussetzung, um mit gezielten Angeboten, »nicht primär dem Leben mehr Jahre, sondern den Jahren mehr Leben zu geben« (Schelling, 1999). Die besondere Aussagekraft des Kompetenzmodells liegt darin, »dass auf dem Hintergrund eines positiven Menschenbildes die Förderung und Unterstützung einer subjektiv bedeutsamen, bedürfnisorientierten, selbstbestimmten und sinnerfüllten Daseinsgestaltung bis ins höchste Alter hinein, ja bis zum Ende eines individuellen Lebens niemals aufgegeben wird« (Theunissen, 2002, S. 42). In einem Kompetenzmodell des Alterns ist es eine zentrale Aufgabe der pädagogischen Begleitung von Personen mit geistiger Behinderung, Selbstbestimmung und Teilhabe erfahrbar zu machen, und insgesamt zur Umsetzung eines auf Stärken ausgerichteten Modells zu gelangen. Als ›Experten in eigener Sache‹ können sie diesen Lebensabschnitt aktiv selbst- und mitgestalten. »Hierzu können speziell Methoden der Persönlichen Zukunftsplanung einen wertvollen Beitrag liefern, indem sie eine konkrete Planung der Alterszukunft vor dem Hintergrund individueller Kompetenzen und Vorstellungen der Betroffenen ermöglichen« (Schuppener 2004, S. 54).
Da Altern jedoch bei Menschen mit und ohne Behinderung einen Prozess darstellt, der durch individuelle Handlungsmöglichkeiten, Persönlichkeitsfaktoren und durch den jeweiligen Lebenshintergrund geprägt ist, weisen alle aufgeführten Theorien in ihren Erklärungsansätzen Grenzen auf. Deshalb sollten die Theorien nicht separat voneinander betrachtet werden, sondern ergänzend und in Kombination.
Eine allein- und uneingeschränkt gültige Theorie erfolgreichen Alterns kann es dementsprechend nicht geben (vgl. ebd., S. 139). Hinsichtlich sonderpädagogischer Bemühungen sollte primär die »konkrete Gestaltung der letzten Lebensphase von geistig behinderten Menschen, die notwendige Unterstützung und Begleitung unter Wahrung von Würde und Selbstbestimmung« (Jeltsch-Schudel 2011, S. 51) im Vordergrund stehen, um jeder Person ein möglichst zufriedenstellendes und erfolgreiches Altern ermöglichen zu können.
4.3.5 Lebenslaufperspektive
Der Lebenslauf eines Menschen hat sowohl eine individuelle Dimension als auch eine Dimension auf Makroebene. Ein Lebenslaufmodell sollte das Mikroniveau, den Menschen mit geistiger Behinderung selbst, mit den individuellen psychischen, körperlichen und sozialen Anpassungen und Veränderungen beim Älterwerden, immer einbeziehen. Auf individuellem Niveau können mindestens zwei Phasen unterschieden werden, nämlich:
• Entwicklungsphase (Reifung und Erziehung; Bildung und Zunahme der Autonomie)
• Altersphase (Reifung und/oder Abnahme der Autonomie durch körperliche Gebrechlichkeit)
Ein umfassendes Lebenslaufmodell umschließt jedoch auch das Makroniveau der sozialen Auffassungen, Normen und Werte über Altern, geistige Behinderung, Integration und Normalisierung in einer Gesellschaft. So könnte eine umfassende Frage lauten: Welche Konsequenzen haben gesellschaftliche, kulturelle, politische, marktwirtschaftliche und wissenschaftliche Entwicklungen für das Ansehen und die Begleitung des Menschen mit geistiger Behinderung während seines Lebens?
Ein sozial-gerontologisches Lebenslaufmodell sollte jedoch auch das Mesosystem einschließen, nämlich die Beziehungen des Menschen mit geistiger Behinderung mit seiner direkten materiellen und immateriellen Umwelt, die physische und soziale Umgebung, z. B. die Familie, die Schule, die Wohngruppe, die Werkstätte, die Tagesstätte. Das Mesoniveau ist von großer Bedeutung für die Position und Aktivitäten der Person mit geistiger Behinderung in den Bereichen Erwachsenenbildung, Förderung, Arbeit, Freizeit, Wohnen, Begleitung, Pflege und Versorgung. Der Mensch mit geistiger Behinderung wird auf diesem Niveau seine Kontakte und sozialen Beziehungen finden müssen, seinen Platz in einem sozialen Netz. Es wird deutlich, dass sich in der Arbeit mit dem behinderten Menschen verschiedene Disziplinen den Entwicklungsaspekten zuwenden.
Die Lebenslaufperspektive und -forschung ist folglich interdisziplinär und hat Vertreter in der Psychologie, Pädagogik und in der Soziologie.
Einer der zentralen Grundsätze der heutigen Auffassung der Lebenslaufperspektive ist, dass es keine einzelne oder spezifische Periode im Leben eines Menschen gibt, die den kontinuierlichen Prozess der menschlichen Entwicklung insgesamt prägt.
In der Gerontologie wird der Alterungsprozess und die Altersphase als Teil des Lebenslaufs verstanden, in dem die Eckpfeiler des aktiven Alterns und der Gesundheit bereits in frühen Lebensphasen gelegt werden (Elder & Giele, 2009). Obwohl es im Alter möglicherweise mehr eingreifende Ereignisse gibt (z. B. Tod von Angehörigen oder Beginn der Demenz), prägen vor allem biografische Ereignisse der Kindheit, Jugend und des Erwachsenenalters die »dritte« und »vierte« Phase im Leben.
Gerade das Akzentuieren einer bestimmten Entwicklungsphase und das Verleugnen einer späteren wird oft zum Problem bei Menschen mit geistiger Behinderung. Schaut man sich Biografien von Menschen mit geistiger Behinderung an, dann wird deutlich, wie abhängig solche Phaseneinteilungen von dem Bildungswillen und der aktiven Gestaltung des Lebens durch die Mitwelt ist. Auch bei älteren Menschen trifft man noch oft auf Bemerkungen wie »Es bleiben doch immer Kinder« oder »Erwachsen werden sie nie«. Wie kann man den Menschen mit Behinderung altersgemäß und mit Respekt begleiten, wenn man ihm oder ihr die Zwischenphasen des Lebenslaufs leugnet und damit abnimmt?
Die psychologische Alternsforschung (Lehr, 1980; Baltes & Baltes, 1990) hat auch für die Gestaltung der Erwachsenenbildung in der Geistigbehindertenpädagogik zur Folge, dass menschliche Entwicklung als ein lebenslanger Prozess betrachtet wird (Rapp & Strubel, 1992; Speck, 1983; Theunissen, 1993). Kognitive, emotionale und soziale Entwicklung endet nicht im Erwachsenenalter oder wird sogar rückläufig, sondern ist bei einer fördernden und stimulanzreichen Umgebung ein kontinuierlich fortschreitender Prozess bis ins hohe Alter. Auch im hohen Alter haben ältere Menschen mit geistiger Behinderung den Willen und die Fähigkeit, für sie wichtige und interessante Sachverhalte zu lernen (vgl. Haveman et al., 2000).
Lernerfahrungen in der Kindheit und Rollenerfahrungen des Jugendlichen haben einen großen Einfluss auf die Entwicklung des einzelnen Menschen; was jedoch nicht bedeutet, dass diese Einflüsse wichtiger und stärker sind als die Erfahrungen der Altersphase. Nach Theunissen (1997) ist die Lebenslaufperspektive, der »life span developmental approach« (Baltes, 1980; 1990), ein Bezugsrahmen für Interventionen, »die den geistig behinderten Menschen auch im fortgeschrittenen Alter in seinem Personsein, in seiner Würde, in seinen Möglichkeiten, in seiner Befindlichkeit und mit seinen Bedürfnissen als ein auf Autonomie hin angelegtes, aktives und kompetentes Wesen ernst nehmen« (Theunissen, 1997, S. 133). Der Einzigartigkeit jedes Menschen im Lebenslauf wird letztlich nur die Biografie gerecht. Die Aufarbeitung der eigenen Biografie hat vor allem für ältere Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Begleitung wichtige Funktionen. Das bedeutet nicht, dass die Vergangenheit wichtiger ist als die Gegenwart oder die Zukunft.
Читать дальше