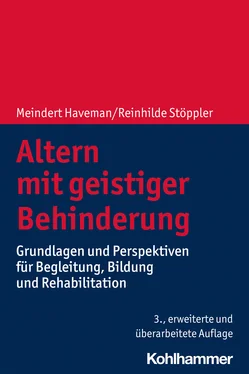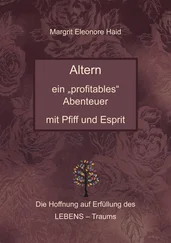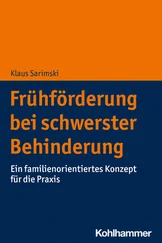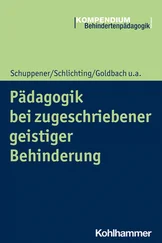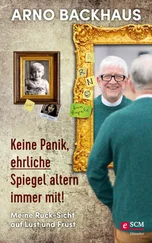Auch das Hörvermögen lässt schon ab ungefähr dem 30. Lebensjahr nach. Durch Veränderungen im Innenohr kommt es zu einem Anstieg der Schwerhörigkeit, die vor allem die Wahrnehmung hoher Tonfrequenzen betrifft.
Herz- und Kreislaufsystem
Bezüglich der Herz-Kreislauf-Funktion lassen sich ebenfalls Veränderungen mit zunehmendem Alter feststellen. Es kommt z. B. zu einer Abnahme der Herzfrequenz (vgl. Steinhagen-Thiessen et al., 1992) und zu einem Anstieg des Blutdrucks bei älteren Menschen. Die anschließende Erholungsphase bis zur Rückkehr des Blutdrucks auf die individuelle Norm ist verlängert (vgl. Gerok & Brandtstädter, 1992).
Die Wände der Blutgefäße verlieren mit fortschreitendem Alter an Elastizität und werden starrer; es kann zur Arteriosklerose kommen. Da das Herz gegen einen zunehmenden Gefäßwiderstand anpumpen muss, neigen ältere Menschen zu einer Blutdruckerhöhung. Aufgrund der Verlangsamung der Regulation des Blutdrucks kann es häufig zu Blutdruckschwankungen kommen. Die Kraft der Herzmuskulatur nimmt mit zunehmendem Alter ab, das Herzschlagvolumen verringert sich. Das Herz kann die durch Gefäßalterungen erhöhte Druckbelastung nur durch Muskelwachstum bewältigen, wodurch eine Herzhypertrophie entstehen kann.
Die Venenklappen werden durch Abnahme der Elastizität des Muskelgewebes insuffizient und es bilden sich Krampfadern aus.
Die Leistung des Atmungssystems nimmt im Alter ab. Durch Abnahme der Beweglichkeit des Brustkorbs verringert sich die Vitalkapazität. Die maximale Sauerstoffaufnahme des Blutes verringert sich um ca. 40 %, da Lungenfunktion und Aufnahmekapazität des Blutes und Pumpleistung des Herzens nachlassen. Die Lungenfunktion wird durch Alterungsprozesse im elastischen und kollagenen Bindegewebe beeinträchtigt, was zu einer Erhöhung des statischen Lungenvolumens und einer Verminderung der Ventilationskapazität führt (vgl. Klein et al., 1988). Der Sauerstoffverbrauch fällt pro Kilogramm Körpergewicht und Minute nach dem 30. Lebensjahr langsam, aber fast linear ab (vgl. Gerok und Brandtstädter, 1992). Diese Veränderungen bedeuten eine starke Einschränkung der Leistungsreserven.
Die Menge verschiedener Verdauungssäfte, z. B. des Speichels, des Magensafts und der Bauchspeicheldrüsensekrete nehmen ab. Es findet eine Rückbildung der Schleimhaut statt. Der Reflex zur Darmentleerung wird schwächer. Zum biologischen Altern gehört bei vielen Menschen ein Nachlassen der Darmtätigkeit, was bei älteren Menschen zu Verstopfung führt (Müller-Lissner, 1994). Im Alter treten häufig Obstipationen (Verstopfungen) auf, die jedoch nicht nur durch physiologische Veränderungen des Verdauungstraktes, sondern auch auf mangelnde Körperbewegung und ungenügende Flüssigkeitsaufnahme zurückzuführen sind. Die Sekretions- und Resorptionsleistung des Magen-Darm-Trakts vermindert sich.
Im Alter kommt es vermehrt zum Nachlassen der Nierenfunktion durch den Rückgang von Nephronen. Das Fassungsvermögen der Harnblase nimmt im Alter ab; die Muskelspannung der Blasenwand erhöht sich. Die Folge ist häufigeres Wasserlassen bei beeinträchtigter Blasenentleerung durch nachlassende Kraft des Blasenschließmuskels, Schwäche der Beckenbodenmuskulatur bei Frauen und Prostatavergrößerung bei Männern. Etwa ein Drittel der über 65-jährigen Frauen und Männer leiden unter Inkontinenz.
Bei der Frau hat die Postmenopause vielfältige Auswirkungen. Organische Veränderungen betreffen vor allem die Rückbildung der Gebärmutter und der Scheidenschleimhaut, wodurch es zur Trockenheit der Scheide und der äußeren Genitalien führen kann. Vegetative Auswirkungen der Hormonumstellung äußern sich z. B. in Hitzewallungen, Herzklopfen und psychischen Problemen.
Bei Männern stellt sich eine Abnahme des Geschlechtshormons Testosteron mit Zunahme der weiblichen Sexualhormone ein, was eine der Ursachen für die Prostatavergrößerung darstellt. Reaktionsbereitschaft der Geschlechtsorgane und sexueller Betätigungsdrang lassen mit zunehmendem Alter nach.
Das biologische Altern findet im Allgemeinen genauso statt wie bei der Gesamtbevölkerung (vgl. Stöppler & Milz, 2007). Einige Personengruppen mit bestimmten Ursachen der geistigen Behinderung wie Down- oder Williams-Syndrom zeigen, wenn sie älter werden, spezifische Merkmale, die als Anzeichen eines frühzeitigen Alterns gedeutet werden. Wie in Kapitel 7 näher erläutert, sind viele der beschriebenen Symptome als Anzeichen von Störungen im Immunsystem oder – wie bei erwachsenen Menschen mit Down-Syndrom – durch eine Alzheimer-Erkrankung zu erklären ( 
Kap. 7
).
4.2 Psychologisches Altern
Auch das Gehirn wird als Organ vom biologischen Altern betroffen. Im Gehirn ist zum einen ein Verlust an Neuronen zu verzeichnen und zum anderen nimmt die Interaktion zwischen den Zellen durch einen Rezeptorverlust für verschiedene Signalmoleküle ab. Diese erschwerte Kommunikation zwischen den Zellen betrifft auch andere Organe (vgl. Danner et al., 1994, S. 200). Mit zunehmendem Lebensalter kommt es zu einer Vielzahl von morphologischen Veränderungen im Gehirn, z. B. zu einer zahlenmäßigen Abnahme der Nervenzellen, Pigmenteinlagerungen in den Zellen, zu einer Verschmälerung der Hirnwindungen und zu einer faserigen Verdickung der Hirnhäute, die auch psychische Konsequenzen haben. Das Hirngewicht sinkt; beim 75-Jährigen erfolgt eine Abnahme des Gewichtes gegenüber einem 30-Jährigen von durchschnittlich 56 %.
Die Konsequenzen können grob in die Kategorien kognitiv und emotional unterteilt werden. Unter kognitive Konsequenzen fallen auch intellektuelle Fähigkeiten. Dabei lassen sich sowohl altersstabile als auch altersabhängige intellektuelle Fähigkeiten feststellen.
Unterschieden wird zwischen flüssigen (fluiden) und kristallinen Funktionen.
»Unter fluider Intelligenz versteht man die stark biologisch determinierte Fähigkeit, figurale Zusammenhänge zu erkennen und abstrakte Schlussfolgerungen bei Aufgaben zu ziehen, die in ihrem Inhalt relativ bildungsunabhängig sind. Mit kristalliner Intelligenz bezeichnet man jene kognitiven Kompetenzen, die notwendig sind, um stark wissensabhängige Aufgaben zu lösen.« (Weinert, 1992, S. 192)
Zu den kristallinen Funktionen gehören bildungs- und übungsabhängige Fähigkeiten, wie z. B. der Wortschatz und Fähigkeiten, die sich mehr auf Allgemeinwissen und Lösungsstrategien beziehen (vgl. Thomae, 1988, S. 11). Die flüssigen Funktionen sind abhängig von der Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung und des Denkens. Während sich die kristalline Intelligenz als relativ altersunabhängig erweist und sich kristalline Funktionen durch geistiges Training bis ins hohe Alter steigern, zeigt sich bei Aufgaben, die die fluide Intelligenz betreffen, eine Verlangsamung der Leistungen, insbesondere bei der Bewältigung von komplexen und unbekannten Aufgaben (vgl. Bartels, 1982, S. 306). Ebenso lässt im Alter in der Regel das Kurzzeitgedächtnis nach (vgl. Weinert, 1994, S. 196).
Die Ergebnisse der gerontologischen Forschung in Bezug auf kognitive Prozesse sind keineswegs nur aus einer biologisch-reduktionistischen Sicht heraus zu interpretieren. Eher ist es das komplexe Zusammenspiel von biologischen Prozessen, das konstante, aber variationsreiche Bestehen von Stimulanzen und Herausforderungen in der sozialen Umgebung und die Fähigkeiten des Copings des Einzelnen (wobei auch Interesse und Motivation eine wichtige Rolle spielen), wodurch Resultate über intellektuelle Fähigkeiten im hohen Alter erklärt werden können. So scheint die intellektuelle Leistung bis ungefähr zum 70. Lebensjahr insgesamt relativ stabil zu sein. Auf Gruppenniveau sind erst ab diesem Alter die Gewinne intellektueller Fähigkeiten geringer als die Verluste (Schaie, 1988, nach Staudinger, 1992). Auch in einer anderen Untersuchung fand man gleichartige Ergebnisse nach dem 70. Lebensjahr. Die Gruppenergebnisse nach Alter verschleiern jedoch große individuelle Unterschiede. So haben in dieser Untersuchung einige Personen der Altersgruppe der 70- bis 80-Jährigen die schlechtesten Werte und einige Personen, die über 95 Jahre alt waren, die besten, einschließlich einer 103-Jährigen (Smith & Baltes, 1993, nach Künzel-Schön, 2000).
Читать дальше