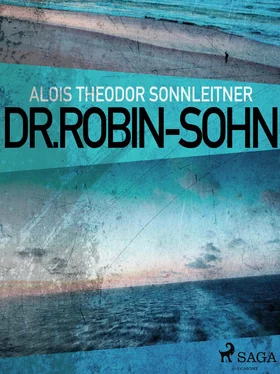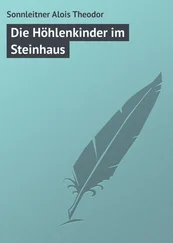Schon umstanden Lorent, Robin, Weisswasser, Eisank und der Laborant den dampfenden Ofen. Von Robins rechter Hand floss Blut auf die vom verschütteten Wasser nassen Kehlheimer Platten und mengte sich mit den Spuren der Schuhe. — „Ja, haben Sie denn das Pfeifen des Ventils überhört?“ fragte Eisank den verlegen dastehenden Magister. — „Es hat nicht gepfiffen, Herr Provisor!“ — „Es hat nicht gepfiffen!“ bekräftigte Lorent. — Weisswasser sah mit seinen etwas hervorquellenden gutmütigen Augen von einem zum andern; dann gab er der Vermutung Ausdruck: „Der messingene Regel im Ventil wird oxydiert sein; da ist er halt unbeweglich festgesessen. — Seit Rotziegels Zeiten hat ja kein Mensch die Blase benutzt. Das hätte ich sollen bedenken und das Ventil untersuchen lassen; aber wer denkt denn auch an alles!“ — Da fiel sein Blick auf die Blutspuren, dann auf Robins Hand. — „Ich hab müssen die Scheiben einschlagen, wegen des Luftdruckes“, entschuldigte sich der Magister. „Sei’n wir froh, dass nicht mehr geschehen ist, die Zimmerdecke hätt’ können einstürzen. Kommen Sie mit nach vorn, ich verbind’ Ihnen die Hand.“
Indessen zerlegte der Provisor mit dem Laboranten den Destillier-Apparat; sie nahmen den Helm mit dem etwas verbogenen Rohr ab und untersuchten das Ventil. Wie Weisswasser vermutet hatte, sass der Kegel im Lager fest. Als der Apotheker mit Robin zurückkam, freute er sich, dass hier keinerlei Verschulden des Magisters vorlag. „Das Ventil geputzt, stärkere Schrauben in den Retortenkranz, und die Destillation kann weitergehen“, war seine Meinung.
Der Laborant hatte den Besen mit einem Tuch umwickelt und wischte den Boden auf. „Josef!“ redete ihn der Herr an. „Sie sind ein lieber, alter Kerl — gut, dass Sie zurechtgekommen sind“; dabei holte er aus der Brieftasche eine zusammengefaltete Banknote und stopfte sie dem Laboranten in die Rechte, die den Besen führte. Mit breitem, verlegenem Lächeln dankte der Diener und fuhr in seiner Arbeit fort.
Koja packte Seestern und Schnecke in Papier, die Schnitzerei steckte er in die Brusttasche.
Er nahm von Robin und den Apotheker-Leuten Abschied, um rechtzeitig heimzukommen, wo noch ein Stück Feldarbeit seiner harrte.
Unterwegs holte er immer wieder das urtümliche Kunstwerk hervor und liebäugelte damit. Dann ging er in einen Hausflur, zog das Tagebuch aus seiner Tasche und schrieb in Kürze das Ergebnis seiner Betrachtung ein: „Ein Gedanke ist Ding geworden! — Was im Inneren des Menschen sich im Falle einer ‚Versuchung‘ abspielt, ist die Bedrohung seines Wesens durch etwas Böses; die Abwehr des Bösen durch einen sittlichen Gedanken wird ihm bewusst. Beides ist in ihm, er aber empfindet das Böse als etwas von aussen Kommendes, während ihm das Gute als sein Wesenskern gilt. Er erlebt den inneren Kampf der Beweggründe und Gegengründe und will den Sieg des Guten, aus dem Grundwillen, aus dem Willen zum Sein und Gedeihen. — Er hat das Bedürfnis, sich den unvorstellbaren Kampf der Gefühle und Gedanken vorstellbar, sichtbar, greifbar und so be-greifbar zu machen. Gewohnt, in Dingbildern zu denken, schafft er dinghafte Darstellungen dieses Kampfes mit Hilfe von Ähnlichkeiten an Sinnbildern. Sein sittliches Wollen veranschaulicht er sich durch einen sieghaften Helden, das Böse durch irgendein furchtbares Wesen: so ist unter dem Schnitzmesser des Negers der Sieg eines Menschen über ein Zwittertier von Krokodil und Panther entstanden, so anderswo der Sieg des vogelflügeligen Erzengels über den fledermausflatterigen Teufel, so anderswo der Sieg des schwertbewehrten Siegfrieds über den Lindwurm, so anderswo der Sieg des Ritters Georg über den Drachen. — Sieg, immer wieder Sieg des Guten über das Böse. Warum? Weil der Mensch die Vorstellung der sieghaften Überwindung des Übels braucht, um selber den Mut aufzubringen für den inneren Kampf. — Das unbeholfene Schnitzwerk des Negers mag komisch, mag lächerlich wirken auf das verwöhnte Auge des Europäers; es ist aber wertvoll als Träger und Vermittler und Eingeber der Zuversicht, dass der innere Kampf zum Siege des Guten führe. — Es ist ein ernstes, wirksames Hilfsmittel der Selbsterziehung eines nach Selbstbehauptung ringenden kindhaften Naturmenschen, der nicht denken und wollen kann, ohne geschaut zu haben.“
Der Weg von Wien nach Giesshübel war lang, das überstandene Erlebte wuchtig.
Koja kam ins Grübeln. In der Apotheke war nichts Arges geschehen; es gab keinen Schaden und keinen Kläger. Aber was wäre geschehen ohne das besonnene und doch waghalsige Eingreifen des Laboranten? Grässliche Explosionen, Hauseinsturz, Brand, Verstümmelung, Tötung schuldloser Menschen. Dann die gerichtliche Fahndung nach einem Schuldtragenden. Die kleine Kleinigkeit, der eingerostete Ventilkegel — nicht vorbeugend geprüft —, konnte Anlass geben zur Anklage wegen Fahrlässigkeit oder Versäumnis pflichtgemässer Vorsorge, Anlass zur Verurteilung des so guten, so mitfühlenden, hilfsbereiten und so verantwortlichen Apothekers. Die Strenge des Gesetzes hätte ihm ungeheure Geldbussen zugunsten der Geschädigten auferlegen, sie hätte ihn vernichten können. Aber die Toten lebendig machen, das hätte sie nicht gekonnt.
Wäre nicht auch Robin strafbar gewesen? Hatte nicht er auch versäumt, das Ventil vor dem Gebrauch zu prüfen? Armer Robin! — Abgehetzt und verbüffelt, wie er seit Jahren war, konnte er leicht etwas Wichtiges „ausser acht“ lassen, wie er den Pantherschädel verkauft hatte, der schon nicht mehr sein Eigentum gewesen war. So durfte es nicht weitergehen. Koja fühlte sich als Freund verpflichtet, den Magister zu ausgiebiger Bewegung in frischer Luft zu veranlassen, damit er nicht verkümmere.
Wie eine Gnade kam es Lorent vor, dass die Explosion weder Robin noch ihn selbst verletzt hatte. Jedem von beiden war das Leben geschenkt, das hätte genommen sein können; da galt es nun, sich der Gnade wert zu erweisen. Robin wollte Arzt werden, ein Helfer; Koja war ein schlichter Lehrer, aber auch er wollte ein Heilbringer sein: den Gedanken der Verantwortlichkeit wollte er in die Seelen der werdenden Menschen pflanzen. Für Leibesübungen und gute Beschäftigung wollte er die Kinder und die Erwachsenen begeistern, dass in gesunden Leibern gesunde Seelen seien.
Für Robin hatte das scheinbar folgenlose Ereignis eine ungeahnte Nachwirkung. Beim Einschlagen der Fensterscheibe war die Strecksehne seines rechten Zeigefingers vom Glas zerschnitten worden. Die Wunde verheilte glatt, aber der Finger blieb krumm.
Als der Magister zur Waffenübung einrückte, wurde er als ein zum Kriegsdienst Untauglicher heimgeschickt. Damit war seine Hoffnung, später als Arzt der Kriegsmarine zu dienen, vernichtet, ja es war überhaupt in Frage gestellt, ob er als Schiffsarzt Unterkommen würde.
Das schrieb er Koja und erwartete einen Ausdruck der Teilnahme; aber vergeblich. — Koja hatte genug mit sich zu tun. Einer seiner Schüler war beim Turnen mit dem Hinterkopf auf die Matratze gefallen und tot liegen geblieben. Der Perchtoldsdorfer Gemeindearzt Dr. Natzler nahm Meningitis (Hirnhautentzündung) als Todesursache an, weil er wusste, dass die Mutter des Knaben an Tuberkulose gelitten hatte. — In der Martini-Kapelle fand die gerichtsärztliche Sektion der Leiche statt. Durch die mikroskopische Untersuchung wurden Tuberkelbazillen in den Hirnhäuten nachgewiesen. Den Lehrer traf keine Schuld. Dennoch schien es Koja ratsam, von dem Ort zu scheiden, wo das Vertrauen der Eltern zu ihm erschüttert worden war, und in Wien eine Anstellung zu suchen. Weil aber dafür die pädagogische Vorbildung an einer Lehrerbildungsanstalt unerlässliche Bedingung war, entschloss sich Koja, den vierten Jahrgang an der Lehrerbildungsanstalt in Wien zu machen. — Indes musste er zur Waffenübung einrücken und die acht Ferienwochen in der Lehrer-Kompagnie der Landwehr abdienen. Dazu kam, dass Urban, der Bruder seiner Verlobten, in Bosnien gefallen war, wodurch die Braut veranlasst wurde, die Verlobung mit Lorent aufzulösen, weil der Bauernhof eines sachkundigen Herrn bedurfte.
Читать дальше