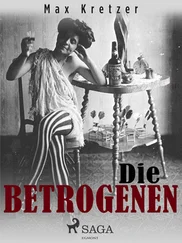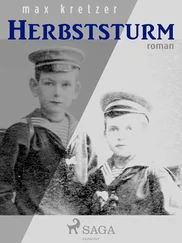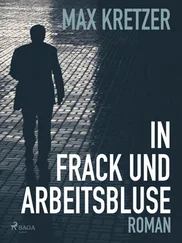Die Besuche wiederholten sich, mehr als es Reinhard lieb war; er baute jedoch auf die Vernunft seiner Schwester. Vernunft, auch du trügst!
Ein Jahr war vergangen. Reinhard war ebenso fleissig als vordem: ein glänzendes Talent, vor dem seine Kommilitonen, die ihn seiner Solidität wegen in der ersten Zeit als Philister verschrien hatten, zuletzt den grössten Respekt hatten. Und Emmy? Der Strudel des Lebens hatte sie ergriffen. Der Hexenkessel, den man Berlin nennt, fing auch für sie an zu brodeln, und der Genuss des Inhalts war zu berauschend, um nicht zu verführen. Heute reich, morgen arm, heute ehrlich, morgen Zuchthaus, heute ein unschuldiger Engel, morgen ein gefallener, — das ist das Kaleidoskop, das man Weltstadt nennt.
Immer später kam Emmy des Abends nach Hause, bis sie eines Nachts ganz ausblieb. Ein kurzer Brief, den er vorfand, sagte Reinhard, dass sie für ihn verloren sei, — immer und ewig: ein Opfer ihrer Schönheit und ihres Leichtsinns.
„... Einziger Reinhard, nach wie vor werde ich Dich in Deinem Studium unterstützen. Jeden Monat werde ich Dir die Hälfte meines Gehalts senden. Bitte, schreibe mir ein paar Zeilen poste restante, dass Du mir verzeihst. Deine unglückliche Schwester.“
Einen Augenblick war es ihm, als müsste er irrsinnig werden; er fasste sich an seinen glühenden Kopf, — dann lachte er hart auf. „Jeden Monat werde ich dir die Hälfte meines Gehalts schicken! Und du denkst, ich könnte ...“ Er fühlte, dass brennendes Rot in sein Antlitz trat. Dann wurde er ruhiger, er war nicht umsonst Mediziner. Sie war doch nur eigentlich das verführte Objekt eines erbärmlichen Subjekts, deshalb nicht zu verurteilen, — aber wehe! Wenn seine Ahnung sich bewahrheitete, wenn sein eleganter Kommilitone es war, der sein Glück zertreten hatte, er wollte Gericht halten. Sogleich wollte er ihn aufsuchen. Aber hatte er Beweise? Wie, wenn er ihm ins Gesicht lachte? Er überlegte. Dann setzte er sich an seinen Schreibtisch und schrieb an die Schwester unter der angegebenen Chiffre:
„Kehre zurück. Wenn auch alle Menschen Dich verurteilen, Du weisst doch, dass die Brust Deines Bruders der Ort ist, wo Du Dich satt weinen kannst. Einen Fehltritt gutmachen, ist eine Wohltat, die man sich selbst, die man der Menschheit erweist; ihn vergrössern, ein Verbrechen. Ich kann nicht leben mit dem Bewusstsein, Dein Herz bluten zu sehen, — komm zurück, geliebte Emmy. Denke an Deinen alten Vater und den Schmerz Deines Bruders. Wer es wagen sollte, auch nur einen Stein auf Dich zu werfen, den überlasse mir und jener Hand der Vergeltung, die jeden seinem Schicksal zuführt. Konntest Du wirklich Deinem Bruder das zutrauen: von Deinem Gelde zu leben, ohne Dich zu sehen, Deine Stimme zu hören? Komm, Emmy!“
Noch spät am Abend trug er den Brief zur Post. Am andern Tage versäumte er zum ersten Male die Vorlesung. Es liess ihn keine Ruhe; er musste sie selbst sprechen. Er stellte sich gegenüber der Post auf und wollte warten, bis sie käme, den Brief zu holen. Vergebens wartete er den ganzen Vormittag; sie kam nicht. Er ging zum Schalter und frug, ob noch ein Brief an Emmy S. da wäre. „Nein“, lautete die Antwort. Sie hatte ihn also durch eine fremde Person abholen lassen. O, Weiberlist!
Niedergeschlagen ging er nach Hause, doch nur, um die Wahrheit des alten Sprichworts, dass ein Unglück nie allein komme, in ihrer ganzen Grösse kennen zu lernen. Ein Brief sagte ihm, dass sein Vater plötzlich gestorben sei. Ein unnennbares Weh beschlich ihn. Er setzte sich hin und weinte. Er war noch kein praktischer Arzt, der mit der Zeit durch die Leiden seiner Patienten seine eigenen vergisst, — er konnte noch weinen. Er rief laut den Namen Emmy, er ging in ihr Zimmer und besah all die Kleinigkeiten, die sie stehen gelassen hatte. „Wenn sie vom Tode ihres Vaters wüsste, sie würde gewiss kommen, so hart könnte sie nicht sein! Weshalb musste ich auch schon so schnell schreiben!“ Dann wurde er wieder ruhiger; er wollte abwarten, vielleicht kam sie doch. Es wurde aber Abend, sie kam nicht. Plötzlich zeigte sich ihm ein Weg, und er musste selbst lächeln, dass er noch nicht daran gedacht hatte.
Er nahm seinen Hut und ging nach ihrem Geschäft. Vor einem Monat schon hatte sie ihre Entlassung genommen. Dieser Schlag war vernichtend. So hatte sie ihn also schon lange hintergangen! Eine tiefe Bitterkeit zog in sein Herz ein. Er haderte mit sich selbst und wusste nicht warum. Stundenlang irrte er noch in den Strassen umher; dann ging er nach Hause. Am nächsten Tag fuhr er nach der Heimat, um seinem Vater die letzte Ehre zu geben. Der war gestorben, ohne eine Ahnung von der Schande seiner Tochter zu haben; dies war der einzige Trost. Er ordnete den Nachlass und kehrte nach Berlin zurück. Wie, wenn sie ihm auf der Schwelle entgegenträte? Täuschung! Kein Brief, — nichts als die schwüle Luft des Zimmers empfing ihn.
Wochen, Monate, endlich drei lange Jahre waren seit dem Verschwinden Emmys vergangen, — alle Nachforschungen waren vergebens. Die Polizei kannte keine Emmy S. Reinhard erliess Aufrufe in den Zeitungen, bat, flehte, drohte, — kein Lebenszeichen kam. Die Jagd nach ihr war eine fieberhafte. Endlich schien er selbst zu verzweifeln. Und was sollte er denn auch noch tun? Hatte er nicht alles getan, was ein Mensch tun konnte? Heute jährte sich zum vierten Male der Tag, an dem sie gemeinschaftlich diese Wohnung bezogen hatten.
Es war abends gegen 10 Uhr, als Reinhard von der Wohnung eines Bekannten, eines braven Holsteiners, heimkehrte. Es war der einzige Studiengenosse, zu dem er wirkliches Vertrauen besass. Als er die Strassen durchschritt, befand er sich plötzlich vor der hellerleuchteten Türe des Orpheums, eines jener eleganten Ballokale, wo das Laster seine nächtlichen Orgien feiert.
Eine Droschke war vorgefahren. Zwei Frauenzimmer stiegen aus; die eine, mittelgross, brünett, ging voran, die andere, schlank, mit hellblonden Locken, ganz in rosa Seide gekleidet, blieb zurück und bezahlte den Kutscher. Sie hatte ihr Gesicht abgewendet; er ging vorüber.
„Aber so komm doch, Emmy, sonst kapere ich dir den Doktor weg,“ klang es plötzlich von heiserer Stimme an sein Ohr.
Er fühlte, wie zwei Bleiklumpen sich an seine Füsse hingen, — er konnte nicht weiter. Er wollte ausrechnen, wie lange es her sei, seit er den Namen Emmy nicht mehr von fremder Stimme gehört, es gelang ihm nicht, er konnte die Ziffern nicht behalten. Dann drehte er sich um, hörte ein übermütiges Lachen, das ihm bis tief in die Seele drang, und hatte in dem weissen Licht der Laternen, das jetzt hell und voll auf die Blondine fiel, seine Schwester erkannt. Er wollte schreien, aber er konnte nicht; es war ihm trocken in der Kehle.
Er fühlte, wie seine Pulse zu jagen begannen und wie das Herz ihm gegen die Brustwand schlug. Einige Sekunden lang hörte er noch jenes eigentümliche Geräusch, das das Knistern und Rauschen der Seide hervorbringt, dann klappte die Glastür zu, und Emmy war verschwunden.
„Wird bald seidene Kleider tragen!“ Er lachte wild auf, so dass die Vorübergehenden ihn gross ansahen. Wieso kam es, dass er jetzt gerade an den dachte, der damals auf dem Bahnhof diese Worte gesagt? Und woher kam es, dass plötzlich der Gedanke bei ihm Raum fand, dieser Doktor, den die Kleine „wegkapern“ wollte, sei kein anderer als Fritz Brand? Er wusste es selbst nicht. Nie ist der Mensch dem Misstrauen zugänglicher als in dem Augenblick, wo seine Vernunft betrogen wird. Er musste Gewissheit haben. Und wehe, zehnmal wehe, wenn er es war, der sein Glück zertrümmert hatte! Bei den Haaren wollte er ihn aus dem Ameisenhaufen der Menschheit zerren und Rechenschaft fordern. Auge um Auge, Zahn um Zahn, und wenn nötig, — dann auch Blut um Blut.
Er suchte in seinen Taschen, er hatte nur wenige Groschen bei sich; sie reichten nicht zum Entree. Aber er musste dort hinein in jenen Saal, den er noch nie betreten hatte, und koste es, was es wolle. Er fühlte nach seiner Uhr, er wollte sie an der Kasse versetzen bis zum andern Tage, aber die Scham hielt ihn davon ab. Da gedachte er seines Freundes, des Holsteiners, und eilte von dannen. Dieser konnte helfen.
Читать дальше