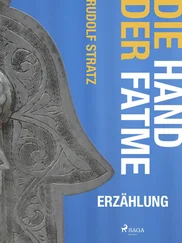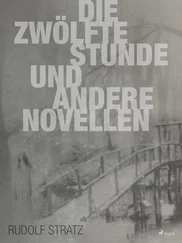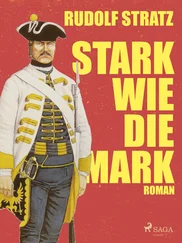„Kann man ihn denn nicht fragen, wer er eigentlich ist?“
Nicolai Sandbauer nahm seinen Tropenhelm und weissen Sonnenschirm. „Versuche es doch! Er wird dir antworten, was er allen zu antworten pflegt: ,Wer unter den Schwarzarbeitern war, hat ein Kreuz hinter sein früheres Leben gesetzt. Das ist begraben. Also lassen wir es ruhen!‘ . . . Und nun komm! Wir wollen zu Papa gehen!“
So zierlich, beinahe kokett die Villa von Sandbauer junior in der Parkvorstadt der Kleinen Fontäne dalag, so grau und düster war der wenige hundert Schritte entfernte „Choutor“ seines Vaters. Seit dem Tode der alten Madame Sandbauer hatte da keine pflegende Hand mehr gewaltet. Alles war verwittert und verwildert. Der Hausherr, der zusammen mit einer entfernten ältlichen Verwandten als seiner Wirtschafterin das stille, zum grossen Teil unbenutzt abgeschlossene Gebäude bewohnte, hatte auch, als er noch gesund war, nie Sinn und Zeit für den äusseren Schmuck des Daseins gehabt. Dazu lasteten zeitlebens die Sorgen des Weizengeschäfts zu schwer auf ihm. Und nun war er krank, todkrank. Gerade heute ging es besonders schlecht. Der alte ungepflegte Diener, der dem Ehepaar öffnete, zuckte auf die Frage Nicolais nur stumm die Schultern: er wisse nicht, ob man mit dem Gospodin werde sprechen können — und schritt dann auf den Fussspitzen voraus bis zu dem Gartenzimmer, das Dominik Sandbauer, seit er das Haus nicht mehr verlassen konnte, halb als Krankengemach, halb als Privatkontor benutzte. An seiner Schwelle liess er die Besucher allein und zog sich geräuschlos zurück.
Die Türe war halboffen. Das Innere hüllten die herabgelassenen Vorhänge in Dunkel. Man konnte nur undeutlich die Gestalt des alten Kaufherrn unterscheiden, der in einem Rollstuhl sass, seine Pflegerin Marussja Sandbauer, eine verarmte stille Witwe, neben sich. Sie war stets schwarz gekleidet. Ihr Mann hatte sich vor zwanzig Jahren in der Nacht, ehe der Konkurs über seine Getreidefirma in Cherson verhängt und er nach russischem Gesetz in Personalhaft genommen werden sollte, erschossen.
Sie war jetzt beinahe die einzige Gesellschaft des Kranken. Ihr erzählte er stundenlang, wenn, wie in diesem Augenblick, die Anfänge greisenhaften Träumens über ihn kamen . . . oder vielmehr seine Gedanken ziellos in die Erinnerung zurückwanderten, zu den Merksteinen, nach denen er sein Leben zählte, den grossen Krisen in der Kornausfuhr, den Jahren der Trockenheit, der Heuschreckennot, der Kriege . . .
Nichts rührte sich. Nur die fast erloschene Stimme Dominik Sandbauers murmelte durch den dämmernden Raum. „. . . Ich war damals noch ein junger Bursch, Marussja . . . ich hatte mich, obwohl ich als Ehrenbürgerssohn die Adelsvorrechte hatte und nicht zu dienen brauchte, in die Opoltschenje, die Reichswehr, aufnehmen lassen und freute mich über meine grüne Uniform und hatte ein Fernrohr. Damit schauten wir aufs Meer, ob sie nicht bald kämen. Und eines Morgens, Marussja . . . das war wie eine Lustspiegelung über dem Schwarzen Meer . . . als kämen alle Schiffe der Welt auf einmal herangefahren . . . wie weisse Mauern . . . Segel an Segel . . . tausend und mehr . . . die ganze See war bedeckt, so weit man sehen konnte . . . das war die Flotte der Verbündeten, Engländer, Franzosen, Piemontesen, Türken . . . nie hatte ein Mensch derlei für möglich gehalten . . . die Muschiks knieten auf der Strasse nieder und bekreuzigten sich: Gott hat uns gestraft! Und in den Kirchen sangen die Mönche: Herr, erbarme dich! Erlöse uns von dem Antichrist . . .“
„Er ist im Krimkrieg!“ flüsterte Nicolai seiner Gattin zu. Sie waren auf ein Zeichen der Wärterin am Eingang stehen geblieben. Lisa nickte nur. Stärker als je empfand sie den leisen Schauer, den ihr auch früher schon die Erzählungen des greisen Schwiegervaters zuweilen eingeflösst. Das war für sie, die in der zweiten Hälfte der Zwanziger stand, so schwer auszudenken, dass ein Mensch noch lebte, der all jene Zeiten und Schicksale Odessas noch mitangesehen, die man heute kaum noch vom Hörensagen kannte — die Jahre, in denen in heissen Sommern der kaukasische Rotwein billiger gewesen war als das Wasser aus den Zisternen — in denen grosse Räuberbanden unmittelbar vor der Stadt in den Klüften der Steppe gehaust und die Tataren ihre Lastkamele durch die ungepflasterten Gassen getrieben hatten. Damals wohnte man hier noch an der Grenze der Wildnis, an der Schwelle des Orients, von der aus sich alljährlich Tausende von Soldaten zum Kampf gegen die Bergvölker des Kaukasus einschifften. Europa war weit, schwer zu erreichen. Man musste durch das Schwarze Meer fahren, durch die Sulinamündung und die Stromschnellen des Eisernen Tores aufwärts in wochenlanger Reise nach Wien. Das alles war so unwahrscheinlich, wenn man sich jetzt in die glänzende internationale Hafenstadt versetzt und ständig durch Eilzüge, Telegraph und Telephon mit Westeuropa verbunden wusste.
Der Kranke drinnen hatte Atem geholt. Dann sagte er müde: „Die Verbündeten haben uns aber nicht viel geschadet, Marussja! Die Stadt liegt zu hoch. Ihre Bomben konnten Odessa nicht erreichen. Vier Kanonenboote kamen bis in den Hafen . . . Eines ist aufgelaufen . . . da hat es mit einer Kettenkugel eine ganze lange Doppelreihe von unseren Soldaten in Stücke gerissen. Man lud sie auf Karren und führte sie weg, um sie zu begraben . . . es bewegte sich noch auf den Karren . . . aber die Treiber riefen: ,Gott mit euch, Brüder!‘ . . . ich hab’ dabei gestanden, Marussja! . . . In den Jahren ist die Ernte auf dem Feld verfault. Niemand konnte Getreide verschiffen . . . Da hasste ich die Franzosen und hatte sie in Paris doch gern gehabt . . . Gerade vorher hatte mich der Vater dorthin geschickt gehabt, wie ich zwanzig Jahre alt war . . . Da hab’ ich unterwegs . . . zum ersten Male in meinem Leben . . . einen Wald gesehen . . . bis dahin nur Meer und Steppe . . .“
Marussja erhob sich leise, als er verstummt war, ging zum Fenster und öffnete den Vorhang. Es wurde hell. Ein Sonnenstrahl lugte herein und spielte über den Kopf des Kranken, der still in den Kissen lag und mit seiner wachsgelben Farbe, den geschlossenen Augen und dem halboffenen Mund schon beinahe an einen Toten erinnerte. Er hatte nichts von derbem Bauerntum an sich, wie andere aus der nun schon fast ausgestorbenen zweiten Generation der in Odessa eingewanderten schwäbischen Kolonisten, deren Kinder und Kindeskinder, soweit sie zu Wohlstand gelangt, längst jede Eigenart abgestreist hatten. Dominik Sandbauer stammte aus dem stubenhockenden grüblerischen Geschlecht der Schwarzwälder Dorfuhrmacher, die jahraus jahrein in ihren einsamen Häuschen sassen und bastelten und sinnierten, und sein Vater noch war zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts mit einem Bündel Uhren auf dem Rücken, den Wanderstab in der Faust, in Odessa eingezogen und erst nach einer günstigen Heirat mit einer Landsmännin aus dem deutschen Kolonistendorf Gross-Liebental, die ihm Kapital mitbrachte, Getreidehändler geworden. Schmächtig und schwächlich wie er war auch Dominik Sandbauer sein Leben lang gewesen, äusserlich ein unscheinbarer kleiner Mann. Aber jetzt noch zeigte der Zug eiserner Starrheit, der unter dem schütteren grauen Vollbart um die welken Lippen eingegraben lag, dass, der da ruhte, in seiner Art kein gewöhnlicher Mensch gewesen — sondern das halb gefürchtete, halb bewunderte Vorbild eines rücksichtslos dem Erfolge alles opfernden, durch keinen Fehlschlag entmutigten Kaufmanns, der das kleine Weizengeschäft, das er als Erbe übernommen, im Laufe eines langen Daseins, über die Leichen anderer Firmen hinweg, zu seiner heutigen stolzen Höhe geführt hatte.
Der Tagesschein weckte den Kranken aus seinem Halbschlaf auf. Seine Augen belebten sich. Er erkannte Lisa. Mit einem freundlichen Lächeln streckte er ihr mühsam, zitterig die Rechte entgegen. Also zurück!“ sagte er leise. Wie geht es?“
Читать дальше