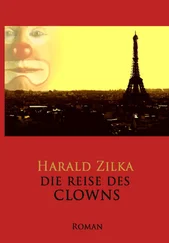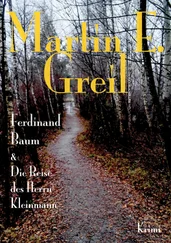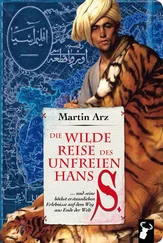»Du musst mit ihm handeln«, sagte ich zu Jamie. »Oder gib ihm einfach die Hälfte.«
Auch das war garantiert noch fürstlich entlohnt. Aber es war nicht mein Geld und ich nicht Jamies Banker. Er bezahlte den Mann und wir gingen los. Es wurde ein langer Nachmittag. Jamie, mit Steckbrief und Rosen, probierte es zunächst an den Verkaufsständen. Niemand erkannte die Person auf den Fotos, doch zur Adresse erhielten wir immer neue, wohlgemeinte Hinweise aus der Bevölkerung. Die Straße stimmte: ein elend langer Prospekt mit labyrinthartigen Nebengeflechten, benannt nach einem Major oder Kommandanten – wahrscheinlich ein Held der Roten Armee oder ein Kosmonaut der Raumstation MIR, der früher allen ukrainischen Kindern Vorbild gewesen war. Wir hatten noch nie von ihm gehört. Wir tappten zwischen den Wohnsilos umher, die Sonne im Nacken. Die Nummerierung der Blockhälften und Hauseingänge ergab für uns keinen Sinn. Viele Zahlen waren abgebröckelt, und die Klingelbretter, sofern vorhanden, waren mit Nummern beschriftet anstatt mit Familiennamen – in Julias Fall ein Bandwurm mit S, dessen kyrillische Version wir sowieso nicht erkannt hätten.
Stunden vergingen und noch immer passte nichts zu Jamies teuer gekauften Adresse. Ich bekam Durst und ich spürte, wie die Resignation hochstieg in meinem Begleiter. Als es schon langsam Abend wurde und wir wieder am Kreisverkehr standen, wagte er einen letzten Versuch bei einer Babuschka, die mit einem Krückstock auf einem Trampelpfad gehumpelt kam. Sie rieb ihre Augen, studierte den Steckbrief, murmelte vor sich hin. Dann zeigte sie auf den Weg, den sie gekommen war.
Wir zögerten. Außer Gebüsch schien es dort nichts zu geben.
»Vielleicht eine Abkürzung«, sagte ich.
»Hoffen wir’s«, seufzte Jamie und flehte die Oma an mit seinen feuchtblauen Augen.
Hinter dem Gebüsch tat sich eine Brache auf, wo ausgeschlachtete Autowracks ihre letzte Ruhe gefunden hatten. Der Pfad in der Mitte funkelte von Glasscherben. Er führte hinunter zu einer von der Sonne hartgebackenen Lehmstraße. Dort stand ein kleines Häuserspalier. Drei Stockwerke hoch, rußgraue Mauern. Vor den Fenstern hing Wäsche. Ein bisschen wie Italien kurz nach dem Krieg. Zumindest so, wie man meint, es bei Fellini gesehen zu haben. Je näher wir kamen, desto mehr wurde Julia endgültig zur Fantasie, zu einer Internetfee, deren Mantelsaum aus digitalem Sternenstaub niemals den Schmutz dieser Straße berührt hatte.
Ein paar Kinder spielten noch draußen. Die Jungs fochten mit Stöcken, wie überall auf der Welt. Jamie zeigte ihnen die Fotos.
»Julia«, sagte einer von ihnen, in einer völlig anderen Aussprache als unserer.
Als wir zu dem Hauseingang kamen, zu dem der Junge uns führte, begann Jamie ein bisschen zu zittern. Ich verstand seine Aufregung; sie sprang sogar über auf mich. Konnte es sein, dass wir doch noch Glück hatten? An der aus rohen Brettern gezimmerten Haustür wehte uns Pissegeruch entgegen. Drinnen war es stockdunkel. Kein Dämmerlicht wie im Hostelgebäude, sondern gefährlich für Leute ohne sicheren Tritt.
»Da wären wir also«, sagte ich in aufmunterndem Ton.
Jamie kramte nach einem Kaugummi, strubbelte seine Haare zurecht. Ich half ihm, die Rosen aus dem Papier zu wickeln, deren Köpfe leider schon hingen, und wünschte Erfolg. Zum Warten setzte ich mich auf ein vergessenes Stück Rohrverschalung vor dem Haus. Am Himmel zog eine Karawane aus orangeroten Wolken. Die Luft roch nach Brackwasser. Ich rauchte, hatte die Fassade des Hauses im Blick und stellte mir vor, wie sich mein neuer Bekannter im Innern treppauf tastete, an wessen Tür er wohl gerade klingelte oder klopfte und was er den erstaunten Bewohnern sagte, wenn aus dem geöffneten Türspalt Licht auf ihn fiel.
Nach einer Weile hörte ich Füße trappeln. Die Haustür flog auf.
»Schnell«, keuchte Jamie, »ins Pomidori !«
Er lief los, die Hände zu Fäusten geballt. Rosen hatte er keine mehr im Arm, das war ein erstes Indiz. Das zweite waren die Freudensprünge, mit denen er über die Brache setzte. Ich folgte ihm in die langen Schatten der Hochhäuser.
Das Pomidori lag im Parterre eines Wohnblocks am Kreisverkehr. Ein Teenagertreff mit Plastikstühlen, flaugrünem Licht und drei Sorten Tiefkühlpizza auf der Karte. Wir gingen hinein, und Jamie, der ganz aufgekratzt war, erklärte mir die Situation. Ich hatte Mühe, seine Stimme aus der lauten Technomusik zu filtern. Eine erste Altersschwäche meines Gehörs, die sich bemerkbar machte. Julia war zu Hause gewesen, erfuhr ich. Sie hatte Jamie persönlich geöffnet, ihn aber sofort wieder weggeschickt, ins Pomidori.
»Please wait me there«, war ihre Bitte, denn sie aß gerade zu Abend mit ihrer Mutter. Danach würde sie kommen.
Ich nickte. Das klang doch gut.
»Und, hat sie dich gleich erkannt?«, fragte ich.
»Klar«, strahlte Jamie. »Sie wusste Bescheid.«
»Super. Und wie wollen wir’s machen? Soll ich spazieren gehen, damit ihr Privatsphäre habt, oder gleich zurückfahren ins Zentrum?«
Er zögerte.
»Nee«, sagte er schließlich, »setz dich hier einfach irgendwo hin, nur nich’ zu auffällig.«
Ich ließ mir Griwna geben von ihm, bestellte Bier und Pizza und setzte mich an einen Tisch in der Nähe der Toiletten. An den anderen Tischen im Raum saßen Teenager oder zumindest sehr junge Leute: die Jungs mit Häftlingsfrisur und in Trainingsanzügen, großspurig und tätowiert, die Mädchen langhaarig und stark geschminkt, in Röckchen und High Heels. Alle waren weiß, nur ein paar von den Jungs hatten einen vielleicht kaukasischen oder türkischen Einschlag. Man rauchte, trank Bier, kaute Pizza, lachte und telefonierte. Die Mädchen begrüßten einander mit Wangenküsschen, links, rechts, die Jungs hieben einander auf die Schultern oder boxten sich in die Bizepse. Der flache Technopuls aus den Boxen, die simplen Refrains lieferten einen Soundtrack der Sorglosigkeit. Genau das Richtige an so einem Sommerabend im Viertel. Herrenhandtaschen wie in der Deribasov Street entdeckte ich nicht. Vielleicht fehlte den Jugendlichen das Geld dafür oder sie fanden die Dinger doof.
Mit hängenden Schultern, als probierte ich tatsächlich, unauffällig zu bleiben, saß ich vor meiner Flasche Obolon und einer Schinkenpizza, die in der Mitte noch nicht ganz aufgetaut war. Draußen vor dem Lokal ging Jamie Durham auf und ab: der Ritter im fremden Reich, gekommen, um die Prinzessin zu holen. Ein Trolleybus schaukelte um die Kurve, die Konduktoren wie Heuschreckenbeine an der Oberleitung. In den Lichthöfen der Ufo-Laternen ballten sich Mückenschwärme. Ich dachte nach. Die Mutter ist also schuld, rekapitulierte ich, dass das Mädel ihn nicht reingelassen hat. Ich musste grinsen. Für mich war es eine Ewigkeit her, dass Eltern in solchen Dingen eine Rolle gespielt hatten. Auch für Jamie musste es eine Weile her sein. Und für Julia? Sie war zwanzig, musste man sie noch überwachen? Andererseits kannte ich die ukrainische Kultur nicht und durfte mir kein Urteil erlauben.
Wie ich so dasaß und Pizza kaute, wurde ich sentimental. Immer wenn ein neues Mädchen hereinkam, stellte ich mir vor, sie sei in Wahrheit eine Verflossene von mir. Ich dachte an meine vielen wunderbaren Affären ... und an die wenigen wahren Lieben, die ein Mann immer im Herzen behält, während die Frauen die ihren ausradieren, weil sie den Schmerz nicht ertragen. Suzanne, Camilla, Griet. Im Geiste standen sie vor mir. Meine Jugendfreundin aus Kapstadt, die Dozentin aus London und die flämische Ärztin, mit der ich bis vor kurzem in Guatemala gearbeitet hatte. Ein Trio, das sich niemals begegnet war, das aber, wie jeder Mann in seiner heimlichen Neigung zur Polygamie hofft, gut miteinander ausgekommen wäre. Keine von ihnen hatte Stöckelschuhe getragen, falsche Fingernägel oder grellen Lippenstift, wie es hier Mode war. Und was hätten sie zu mir gesagt, wenn sie mich in dieser verrauchten Pizzabude in der nördlichsten Schlafstadt Odessas entdeckt hätten und zu mir an den Tisch getreten wären?
Читать дальше