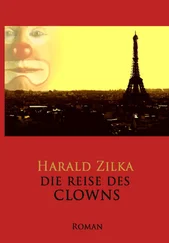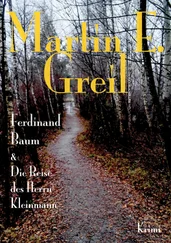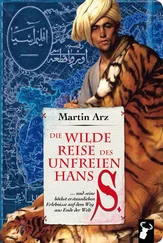Jamie saß auf der Couch, als hätte er sich keinen Millimeter bewegt. Ich nickte einen Gruß, setzte mich auf meinen Platz. Weil im Hostel noch alles schlief, hörte man das leiseste Geräusch: das Knistern der Glut an meiner Kippe, das Schnippen des Zeigefingers, wenn ich Asche abklopfte. In diese Stille hinein knurrte mein Magen. Und wie zur Antwort knurrte der Magen von Jamie.
Jamie stand auf.
»Weißt du zufällig, wo man hier was zu essen herkriegt?«, fragte er mich, offenbar dankbar für den Gesprächsanlass.
Ich blies Rauch aus.
»Klar. Hast du Griwna dabei?«
Er hatte reichlich. Griwna und Dollar, Euro und Pfund. Eine halbe Reisebank steckte zwischen den Lederlappen seines Portemonnaies. Er zeigte mir die Scheine, und seine Finger zitterten, so unterzuckert war er bereits.
Ich sagte: »Okay, dürfte reichen.«
Wir gingen über die Deribasov Street. Wie wir so nebeneinanderher liefen, hätte man uns aus der Ferne vielleicht für eine Neuausgabe von Don Quijote und Sancho Pansa halten können, beim Näherkommen eher für einen alternden Hippie und seinen Neffen aus dem Mainstream. Ich wusste noch nicht, was Jamie nach Odessa geführt hatte. Es war mir herzlich egal. Hauptsache, er bezahlte mein Frühstück. Wir kamen zum Kathedralenplatz, wo die einheimischen Opas schon vormittags über ihren Schachbrettern brüteten und ihre Enkel auf Ponys ritten. Das Bistro an der Ecke war gut besucht. Es roch nach Knoblauch und Milch, und irgendwie hatte die Sowjetzeit hier überlebt – vielleicht in den weißen Häubchen der Köchinnen oder im Dunst, der aus den Töpfen und Pfannen stieg. Wir nahmen Tabletts, reihten uns ein in die Schlange vor den Vitrinen. Es gab Salate, Borschtsch und Soljanka, gefüllte Pasteten, Kürbismus, Schnitzel und Steaks, Hähnchen, Fisch und allerlei Würstchen, und zum Dessert Nougatcremetorten, Mohnzöpfe und Fruchtgelee. Ich war nicht bescheiden, und auch Jamie lud sein Tablett voll. An der Kasse bezahlte er für mich mit.
Wir saßen einander gegenüber am Fenster, mit Blick auf die Straße, auf der Autos und Kleinbusse holperten. Wir aßen schweigend. Gegen Ende der Mahlzeit hatte ich ein Déjà-vu. Ich glaubte plötzlich, Jamie zu kennen. Ihm schon einmal begegnet zu sein. Das war kaum möglich, wegen der Altersdifferenz und den unterschiedlichen Biografien. Er war fest angestellt im Call Center seines Heimatdorfs, wie er mir später erzählte. Ich war weltweit unterwegs gewesen mit Entwicklungshilfeprojekten. Und trotzdem. Solche Verwechslungen kommen vor. Man muss sie verzeihen. Zu vieles begegnet uns mit den Jahren, als dass unser Gedächtnis noch alles richtig sortieren kann. Das Ergebnis ist eine Art Morphing, mit dem es all die Gesichter, Farben, Geräusche, Düfte und andere Eindrücke verschmilzt, die es speichert. Das Gedächtnis besteht nicht aus sauber getrennten Schichten. Es ist eine vieldimensionale Matrix, die ständig vergleicht und Wiederholungen sucht, weil sie das Vertraute und Ähnliche liebt.
Hatte ich Jamie Durham schon einmal gesehen oder erinnerte er mich nur an jemanden? Gott sei Dank, ich erkannte den Unterschied noch. Ich war noch nicht wie mein Vater, der durch die Katakomben seiner Erinnerung irrte, während Mutter mit ihren Freundinnen zum Bridgespielen ging. Jamie katapultierte mich zurück zu einem Sonntag, der ein Vierteljahrhundert in der Vergangenheit lag. Anfang der Achtzigerjahre. Wir waren fertig mit essen, er kaute am Daumennagel und guckte dabei aus dem Fenster, eingeschüchtert vom Unbekannten dort draußen. Sein Nägelkauen war unbewusst. Eine alte Gewohnheit. Bis er den Daumen in den Mund schob, wie ein Trost suchendes Kind. Dabei ertappte er sich und zog den Daumen schnell wieder heraus. Er wurde rot im Gesicht, was bei ihm aussah, als blühten die Sommersprossen. Ich tat natürlich, als hätte ich nichts gemerkt, doch dieser kleine Moment löste das Déjà-vu in mir aus.
Ich war damals achtzehn gewesen, sagenhaft jung, hatte das Matric-Zeugnis frisch in der Tasche und war gerade angekommen in London. Von daheim war ich weg, um der Armee zu entgehen. Zwei Jahre sinnloser Drill auf Afrikaans und dazu die Gefahr, in die Kriege geschickt zu werden, die das Regime in Namibia und anderswo führte ... Darauf hatte ich keine Lust. Ich hatte ein gutes Internat absolviert, wie es sich schickte in meiner Familie, und nun ging ich zum Studium ins Land meiner Vorfahren.
Zurück nach Südafrika durfte ich als Deserteur nicht. Nicht einmal auf Besuch, sonst drohten Gefängnis und Strafdienst. Ich war jung und dachte darüber nicht nach. Das Exil bedeutete für mich den Aufbruch ins Erwachsenenleben, keine erzwungene Emigration. London war aufregend zu jener Zeit. Es gab keine Rassenschranken, und es gab viele andere Saffas wie mich, die schnell berüchtigt wurden für ihr Saufen und die Arroganz, mit der sie über die engen Wohnungen klagten, das schlechte Wetter, die kleinen Portionen Fleisch. Mein Vater, enttäuscht wegen meiner Flucht vor der Pflicht, wie er das Desertieren nannte, hatte mir die Mittel gestrichen und wollte mich am liebsten nie wiedersehen. Wir hatten uns überworfen, und deshalb studierte ich nicht in Oxford oder Cambridge, sondern an einer bescheideneren Einrichtung in der Hauptstadt. Mutter und meine Schwester Rosalie schrieben mir regelmäßig. Mutter knüpfte für mich Kontakt zu einem Zweig ihrer Familie, der zu Beginn des Jahrhunderts nicht ausgewandert war und noch in London wohnte. Eine Urenkelin der Großtante zweiten Grades, so ungefähr. Ich versprach, diese Leute einmal zu besuchen, und fand mich an einem verregneten Tag in einem Reihenhäuschen in Clapham wieder.
Die Gesichter am Tisch sind mir abhandengekommen; hier lässt mich die Gedächtnismatrix im Stich. Aber ich weiß noch, wie ich mich fühlte. Ich hatte Liebeskummer. Meine Freundin Suzanne hatte aus Kapstadt geschrieben, dass sie nicht wie geplant nachkommen werde. Sie war die Tochter unserer Nachbarn in Newlands, meine erste Liebe, und jetzt war sie mit einem Kumpel von mir zusammengekommen. Das wurmte mich schrecklich. Außerdem musste ich beim Anblick des mickrigen Pinschers, den die Verwandten als Hund bezeichneten, an Lloyd denken, Vaters Dobermann. Er war auf den Geruch menschlicher Rassen trainiert, doch er erkannte das innere Wesen und war immer freundlich zu unseren Dienstmädchen, Gärtnern, Chauffeuren, nie aber zum Chef meines Vaters, wenn der mit seiner Frau zum Braai-Grillen kam. Ich vermisste Lloyd. Ich vermisste Suzanne. Und ich hasste den Londoner Regen.
Meine Verwandten behandelten mich mit einer Mischung aus Abscheu und Faszination. Oh, du kommst aus diesem schrecklichen Land!, sagten sie. Wir kaufen eure Orangen nicht mehr! Gleichzeitig merkte ich, dass sie auf eine Einladung spekulierten. Safari im Kruger Park, Sonne tanken am Strand von Durban, wilde Negertänze in KwaZulu-Natal. So stellten sie sich den Traumurlaub vor. Sie hatten zwei Kinder: ein Mädchen im Teenageralter, das meinem Blick auswich, um mich heimlich anzustarren, und einen Jungen von vier oder fünf. Er hatte rötliches Haar und Myriaden von Sommersprossen, ein richtiges sproetgesig , wie man auf Afrikaans sagen würde, und er lutschte noch Daumen, wofür ihn die Eltern ständig ermahnten und ihm kleine Klapse auf den Kopf gaben. Nach dem Essen fasste er einen mutigen Plan. Er kam zu mir, dem Fremden am Tisch, kletterte auf meine Knie und rollte sich ein wie ein Tierjunges. Geschützt vor dem Zugriff seiner Familie, lutschte er Daumen. Ich fühlte mich überrumpelt. Dieses Kind suchte Zuflucht bei mir! Und obwohl er mir nicht sympathischer war als der Rest der Verwandtschaft, keimte ein Gefühl der Verantwortung in meiner Brust. Ein väterliches Gefühl, möchte man sagen. Eine Vorahnung meines Berufs. Denn was sind Entwicklungshelfer anderes als Eltern auf Zeit, mit allen Gefahren der Überheblichkeit und seelischen Korruption?
Читать дальше