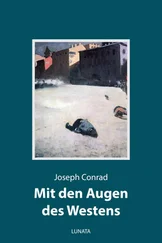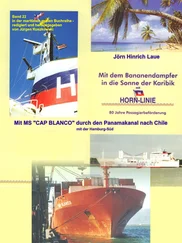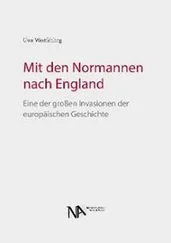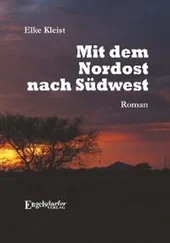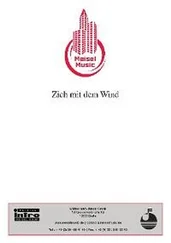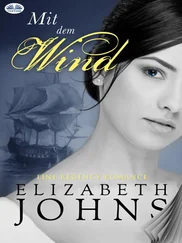Als Günter Wetzel und Petra Krause am 14. Februar 1974 heiraten, sind auch Peter und Doris Strelzyk dabei. »Die sozialistische Ehe« wird im Standesamt des Rathauses von Pößneck geschlossen. Eine Beamtin streift der damals 19 Jahre alten Braut und dem gleichaltrigen Bräutigam die preiswerten Eheringe über und drückt ihnen das in grünes Kunstleder gebundene »Buch der Familie« in die Hände.
Die Braut trägt ein weißes Kleid mit Blumenstickereien, weiße Margariten im Haar und einen schulterlangen weißen Schleier. Der Bräutigam hat sich in einen schwarzen Anzug geworfen, aus dessen Brusttasche ein Strauß Maiglöckchen guckt. Eine weiße Schleife ziert sein gestärktes Hemd. Seinem rosig frischen Gesicht sieht man an, daß er viel an der frischen Luft zu tun hat. Günter Wetzel ist mittelgroß, untersetzt und kräftig. Er hat muskelgestählte Oberarme und schwere Hände, die zupacken können, ein ruhiger, eher schüchterner junger Mann, der von sich sagt: »Ich ärgere mich manchmal darüber, daß ich nicht so schnell Kontakt schließen kann, aber manchmal finde ich es auch wieder gut, daß ich relativ ausgeglichen bin und nicht so schnell aus der Fassung komme.«
Günter Wetzels Familienverhältnisse sind kompliziert. Sein Vater ist in die Bundesrepublik geflüchtet, als er noch ein kleiner Junge war. Günter Wetzel wächst bei seiner Mutter auf. Er verbringt seine Schulzeit in dem Dorf Grobengereuth bei Pößneck. »Es war alles in allem eine schöne Zeit«, sagt er, »auf dem Lande hat man als Kind doch viel mehr Freiheit als in der Stadt.«
Er ist kein besonders guter Schüler, er ist technisch begabt, aber im Unterricht schüchtern und zurückhaltend. Mit zehn oder elf Jahren schon baut er sich sein erstes Radio, zwei Jahre später bastelt er ein schrottreifes Moped Marke »Star« wieder zusammen und fährt damit über Dörfer und Feldwege. Später repariert er die Motorräder der Jugendlichen und Erwachsenen auf dem Dorfe.
Für Politik interessiert sich der junge Motorexperte kaum. »Mir war damals noch nicht einmal so richtig bewußt, daß wir ja in einem geteilten Land leben und daß Grobengereuth nur ein paar Kilometer von der Grenze entfernt ist.« Doch dann stolpert er bei der Kartoffelernte, bei der er und seine Schulkameraden in jedem Jahr helfen müssen, in einer Ackerfurche über einen seltsamen Gegenstand. »Da lag so eine komische Apparatur am Boden, eine Zeituhr, und daran war ein Paket. Ich wußte nicht, was das war, aber ich habe es in meine Tasche gesteckt und mit nach Hause genommen.«
Als er zu Hause die Verpackung öffnete, findet Günter Wetzel eine Broschüre mit dem Titel: »Wo lebt man besser?« Er hat einen Gruß vom damaligen Bonner Innerdeutschen Ministerium gefunden, der »An die deutschen Bürger in der Sowjetischen Besatzungszone« adressiert war. Die westdeutsche Propagandabroschüre war zu Zeiten des kalten Krieges vom Bundesgrenzschutz an einem Gasballon befestigt, mit dem Wind nach Osten über die »Zonengrenze« geschickt worden. Durch eine Zeituhr wurde die Ladung des Ballons ausgeklinkt und über DDR-Gebiet verstreut – Dutzende, manchmal Hunderte von Flugzetteln, Broschüren und Büchern. So ein Buch hat Günter Wetzel gefunden und bis heute aufbewahrt.
»Freunde, denen ich meinen Fund heimlich gezeigt habe, erzählten mir, dies sei ›Hetzmaterial‹ und man müsse es bei der Volkspolizei abgeben. Das habe ich aber nicht getan. Im Gegenteil, ich bin neugierig geworden, was in dem Buch wohl stehen würde.« Günter Wetzel findet darin Vergleiche über das Leben in der Bundesrepublik und in der DDR, über Löhne und Preise. Dort steht, welcher Wohlstand in der Bundesrepublik herrsche, auch, daß es dort mengenweise Autos verschiedener Fabrikate zu kaufen gibt. Von nun an interessiert er sich mehr für den Unterschied zwischen Deutschland-Ost und Deutschland-West. Die Bonner Aufklärer haben im Fall Günter Wetzel ihr Ziel erreicht.
Nach der 8. Klasse, mit 14 Jahren, verläßt der Junge vom Lande die Grundschule. »Ich war in meinen Leistungen ziemlich abgefallen, weil mich der Unterricht nicht sehr interessierte und wohl auch, weil ich ganz schön faul gewesen bin.«
Deswegen bekommt er auch keine Lehrstelle als Kraftfahrzeugmechaniker, wie er es sich einmal gewünscht hat, sondern einen Ausbildungsplatz als Maurer beim volkseigenen Betrieb »Hoch- und Tiefbau Pößneck«. Drei Jahre lang hilft der Lehrling mit Maurerkelle und Mörtel beim Aufbau des »ersten sozialistischen deutschen Staates«. Unter anderem ist er dabei, als das Neubaugebiet in Pößneck-Ost hochgezogen wird. Günter Wetzel bekommt breite Schultern und kräftige Armmuskeln. Ein Freund nimmt ihn mit zum Sportverein »Rotation Pößneck«. Dort stemmt er am Wochenende als Gewichtheber zentnerweise Eisen-Hanteln.
»Nach der Lehrzeit wollte ich noch einmal zur Schule gehen und das 9. und 10. Schuljahr nachmachen, damit ich endlich Automechaniker werden konnte.« Aber ihm kommt etwas dazwischen. An einem Sommertag 1973 fährt der sportliche junge Mann auf einem selbstzusammengebauten Motorrad mit einem Freund auf dem Soziussitz zum Malteich oberhalb von Pößneck. Die beiden Männer springen in das kühle Wasser des idyllisch gelegenen, von Schilf und Wald umgebenen, kleinen Sees. Sie sind allein. Da entdecken sie am anderen Ufer ein Mädchen, das eine Angel ausgeworfen hat. »Und so kam es, daß ich geangelt worden bin«, erzählt Günter Wetzel.
Das Mädchen mit der Angel erinnert sich so: »Ich war erst sauer, weil ich Karpfen fangen wollte; und als die beiden da angeschwommen kamen, habe ich gerufen: ›Haut ab, ihr vertreibt mir die Fische!‹« Aber das habe wohl nicht sehr überzeugend geklungen, denn eigentlich sei sie ganz froh über die Abwechslung gewesen. Schließlich sitzen die beiden jungen Männer neben der Anglerin, beginnen ein Gespräch, aus dem sich für Günter Wetzel ein Flirt entwickelt. Die Anglerin erzählt, daß sie am Malteich zusammen mit einigen Erwachsenen die Sommerferien verbringe. Ihr Zelt steht am Waldesrand. Nach einiger Zeit verabschieden sie sich. Das Mädchen sagt: »Wenn Ihr wollt, könnt Ihr ja mal wiederkommen.«
Günter Wetzel kommt schon am nächsten Tag wieder. Er tut so, als ob er seinen Schlüsselbund verloren hat. Und als er der Anglerin gegenübersteht, weiß er nicht so recht, was er sagen soll. Doch dann kommen sie ins Gespräch. Sie lernen sich in den nächsten Wochen und Monaten näher kennen und verlieben sich. Ein Jahr später heiraten sie im Standesamt in Pößneck. Aus Petra Krause wird Petra Wetzel.
Zur Hochzeit wird der jungen Frau von ihrer Pflegemutter ein zweistöckiges altes Haus in der Pößnecker Tuchmacherstraße überschrieben, denn die will gerade – nach Erreichen des Rentenalters – zu ihren Angehörigen in die Bundesrepublik übersiedeln. Günter Wetzel sagt: »Wir haben uns sofort mit Begeisterung an die Arbeit gemacht, um dieses alte, ziemlich brüchige Gebäude wieder in Schuß zu bringen. Als Maurer konnte ich dabei natürlich vieles selber machen.«
Nach seiner Ausbildungszeit hat er mehrfach die Stelle gewechselt und sich dabei immer verbessert. Er arbeitet bei der »Produktionsgenossenschaft Aufbau« in Pößneck als Baumaschinist, weil seine Liebe immer noch den Motoren gehört, dann für die ZEW, für die »Zwischengenossenschaftliche Einrichtung Wald«, einen staatlichen Forstbetrieb, im Orlatal als sogenannter Rücke-Traktorist. Mit einem Traktor zieht er abgeholzte Baumstämme aus dem Wald und fährt frisch geschlagene Thüringer Tannen mit einem Lastwagen in die Sägewerke. »Aber ich konnte auch Automotoren und Motorsägen reparieren. Da war dauernd etwas kaputt, und mir hat es Spaß gemacht, das wieder in Ordnung zu bringen, obwohl ich ja gar nicht Mechaniker gelernt hatte.«
Zwei Jahre später sattelt Günter Wetzel zum VEB Kraftverkehr Saalfeld über. Jetzt fährt er einen sogenannten »Möbelkoffer«, einen Lastwagen Marke Skoda, durch die DDR. Er transportiert Möbel aus den Fabriken Thüringens in die Geschäfte der ganzen DDR zwischen Rostock und Leipzig. Dabei ist er oft tagelang unterwegs. Er sagt: »Oft habe ich bis zu 270 Stunden im Monat gearbeitet, und dafür habe ich etwa 900 bis 1000 Mark bekommen.«
Читать дальше