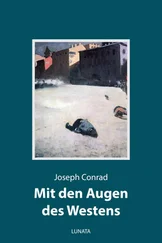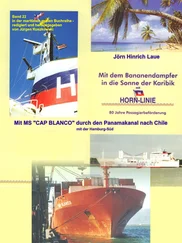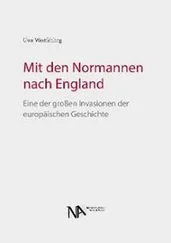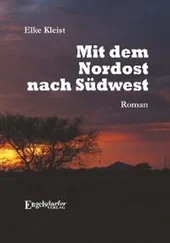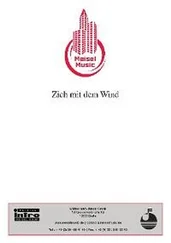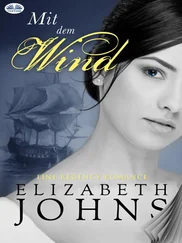Als dritte Vorstellung des Arbeiter-Theaters wird »Der Schatten eines Mädchens«, ein Stück des DDR-Schriftstellers Rainer Krendl, gegeben. Es handelt vom Ende des Zweiten Weltkrieges in Polen, und es ist auch schon das Ende des Arbeiter-Theaters von Pößneck. »Einige Leute hatten keine Zeit mehr. Sie mußten sich zu sehr um ihre Arbeit kümmern, und da ging die ganze Truppe schließlich sang- und klanglos auseinander.«
Die Souffleuse und der Laiendarsteller aber bleiben zusammen. Nach drei Jahren sagt sie ihm im Standesamt von Pößneck das Ja-Wort vor, – am 17. Juni 1966, der im Westen als Tag der deutschen Einheit gefeiert wird. »Diesen Hochzeitstermin hatten wir nicht extra ausgewählt«, sagt Peter Strelzyk, »aber damals habe ich mich schon ein bißchen für Politik interessiert, und irgendwie fand ich dieses Datum als Symbol sehr gut für unsere Ehe.«
Die erste Wohnung der Eheleute Doris und Peter Strelzyk ist zwölf Quadratmeter groß, ein Zimmer mit Handspülbecken. Das Klo ist unten auf dem Flur. Ihr Sohn Frank muß sein erstes Lebensjahr in dieser Enge verbringen. Peter Strelzyk rennt von einer Behörde zur anderen, vom Betriebsleiter zum Rathaus und zur Partei, um eine größere Wohnung zu bekommen. Immer vergebens, immer hört er dieselbe Antwort: »Sie sind doch nicht in der Partei, Herr Strelzyk! Da sind noch viele Genossen vor Ihnen dran, die brauchen ebenso dringend eine größere Wohnung.«
Da habe er zum ersten Mal »eine richtige Wut« auf diese Funktionäre bekommen, sagt der junge Familienvater. Er habe es in »diesem dunklen Loch« nicht mehr aushalten können. Schließlich drohte er, sich mitsamt seiner Familie in einem Zelt auf dem Marktplatz von Pößneck als Wohnungs-Notleidender zur Schau zu stellen. Er ging zur Lokalzeitung »Volkswacht« und kündigte diese Protest-Aktion an. »Daraufhin kam ein humorlos dreinschauender Mann zu uns und sagte, wenn ich Ärger mache, würden sich ›andere Organe‹ um mich kümmern – also der Staatssicherheits-Dienst.«
Eines Tages habe er doch nachgegeben. »Ich habe das Aufnahme-Formular für die SED unterzeichnet, das sie mir ständig unter die Nase gehalten haben.« Wenige Wochen später klappt es bereits: Die Eheleute Strelzyk können eine Wohnung in der Pößnecker Friedrich-Engels-Straße beziehen, gleich unter dem Dach. »Eine Bruchbude war das«, erinnert sich Peter Strelzyk, »aber man konnte was draus machen.« Drei Jahre später, 1970, wird im ersten Stock desselben Hauses eine größere Wohnung frei. »Da habe ich eine richtige Komfort-Wohnung draus gemacht – für DDR-Verhältnisse. Ich habe tapeziert, habe Toilette, Bad und Gaszentralheizung eingebaut, sogar den alten Kamin habe ich wieder in Betrieb gesetzt.«
Nach vier Jahren bekommen die Strelzyks ein zweites Kind. Andreas wird der Junge genannt. Für die nun vierköpfige Familie ist es in der Wohnung zu eng, und da das Haus direkt an einer viel befahrenen Durchgangsstraße liegt, hat die Mutter ständig Angst, wenn die Kinder draußen spielen. Peter Strelzyk – im VEB Polymer inzwischen auf der Karriereleiter und in der Gehaltsstufe nach oben geklettert und als SED-Mitglied mit guten Beziehungen ausgestattet – sieht sich nach einem eigenen Haus um. Etwas außerhalb sollte es gelegen sein, und einen Garten für die Kinder sollte es haben. 1975 klappt es.
Am Altenburgring finden sie ein älteres, aber noch solides Haus, Baujahr 1930. Sie kaufen es für nur 8300 Mark, den Einheitswert von 1914, von der kommunalen Wohnungsverwaltung. Peter Strelzyk erklärt: »Es ist bei Altbauten in der DDR so üblich, daß der alte Taxwert noch heute gilt. Das ist schon sehr günstig drüben.« Mit einem Renovierungs-Kredit von 30000 Mark und mit viel Eifer und Eigenarbeit macht Peter Strelzyk aus »der alten Bruchbude ein Schmuckkästchen«. Freunde helfen ihm dabei. »Wir haben mit dem Hammer erst mal die Wände rausgehauen, um größere Räume zu bekommen.« Neue Wände werden hochgezogen, eine Kohle-Zentralheizung wird gebaut, ein neues Bad, eine neue Toilette. Ein Teil des Kellers wird Garage mit einer schrägen Einfahrt. Alles in allem ziehen sich die Renovierungsarbeiten über Jahre hin. Es gibt immer wieder Lieferschwierigkeiten bei den Materialien. Mal ist wochenlang kein Tapetenkleister zu haben, dann gibt es jahrelang keine Fliesen fürs Bad. Die Badewanne hat zwei Jahre Lieferzeit. Der Tischler, der die Haustür nach Maß machen soll, sagt, es würde etwa zwei bis drei Jahre mit der Fertigstellung dauern, so lange sei er ausgebucht.
Dennoch – die Strelzyks sind stolz auf ihr kleines Wirtschaftswunder. »Nach und nach haben wir uns auch neue Sachen angeschafft. Eine Schrankwand fürs Wohnzimmer, Polstermöbel in Goldgelb und in Rot, eine Stereo-Anlage und ein Schwarz-Weiß-Fernsehgerät.« Die Wohnzimmerwände täfelt Peter Strelzyk mit wärmedämmenden Kunststoff-Schaumplatten. »Die waren nicht billig, die haben 13,90 Mark das Stück gekostet, und auf einen Quadratmeter gehen neun Platten, und ich hatte 16 Quadratmeter zu vertäfeln.« Gleich links neben der Tür stand das Prachtstück des Wohnzimmers, ein Kamin. »Den habe ich mit weißen Riemchensteinen verkleidet, aber leider durfte ich ihn nicht in Betrieb setzen, denn es hätte wegen der Mischung mit anderen Gasen Explosionsgefahr im Schornstein bestanden.«
Durch die Prämien, die er für seine Verbesserungsvorschläge im Betrieb bekommt, reicht es sogar zur Anschaffung eines zehn Jahre alten, gebrauchten »Moskwitsch«. Die Ehefrau Doris verdient als Sachbearbeiterin in der Kreissparkasse Pößneck ja auch noch vier- bis fünfhundert Mark im Monat dazu. Wie es in der DDR üblich ist, werden ihre Kinder zuerst in der Kinderkrippe und später im Kindergarten betreut, und schließlich besuchen sie die Ernst-Tählmann-Schule.
Die Strelzyks haben es zu Wohlstand und Ansehen gebracht. Ihre Straße, der Altenburgring, gilt als gute Adresse in Pößneck. Hier wohnen geachtete Bürger, Leute, die in der Kleinstadt-Hierarchie etwas gelten. Die Nachbarn sind meist stramme SED-Genossen, drei Mitglieder des Kreisrates wohnen in den Häusern zur Linken, gegenüber ist das Haus eines früheren Bürgermeisters, daneben lebt ein Gewerkschaftsfunktionär vom FDGB, dem »Freien Deutschen Gewerkschaftsbund«. Dann ist da noch die Station der Volkspolizei, und gleich um die Ecke, in der Körnerstraße, wohnen der Betriebsleiter des VEB Polymer und der für Peter Strelzyks Partei-Kollektiv zuständige Sekretär der Sozialistischen Einheits Partei, Kreisleitung Pößneck.
Trautes Eigenheim, ausgeglichenes Familienleben, Erfolg im Beruf – eigentlich hätten die Strelzyks rundherum zufrieden sein können. Doch dann macht Peter Strelzyk, wie er es nennt, einen Fehler, »den man unbedingt vermeiden muß, wenn man das Leben in der DDR ertragen will«.
Er habe angefangen, sich intensiver für Politik zu interessieren. Er vergleicht die reine kommunistische Lehre von »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« mit der Wirklichkeit in der DDR. Er mißt die ständige Propagandaberieselung von immer neuen Erfolgen im sozialistischen Wirtschaftswettbewerb, von der angeblichen Steigerung des Lebensstandards an der Realität des Alltags. Er kommt zu der Erkenntnis: »Gerade in den letzten Jahren ist es nicht besser, sondern eher schlechter geworden. Es gab immer größere Versorgungsschwierigkeiten, die Preise stiegen, und besonders der Spielraum für eigene Gedanken und Meinungen wurde immer mehr eingeengt.«
Peter Strelzyks Zweifel am gleichgeschalteten Leben in der DDR wächst sich schließlich zur Verzweiflung aus. »Es ist auf die Dauer unerträglich, wenn man immer nur das nachplappern darf, was die Partei erlaubt.« Er sieht die Verhältnisse in der DDR anders als die prominenten Systemkritiker, anders als die Intellektuellen Robert Havemann, Wolf Biermann und Rudolf Bahro – der »Verdiente Aktivist« Strelzyk kritisiert den Zustand des ersten deutschen Arbeiter- und Bauern-Staates aus der Perspektive des total verwalteten Werktätigen. »Was mich zuerst gestört hat, waren diese billigen Propaganda-Lügen, diese Schwarz-Weiß-Malerei, nach der bei uns alles gut und im Westen alles schlecht ist.«
Читать дальше