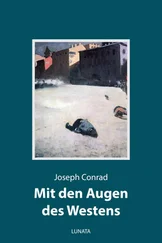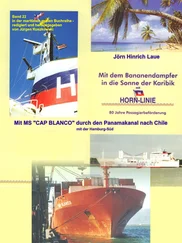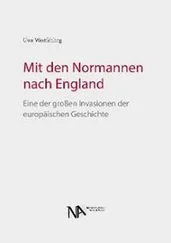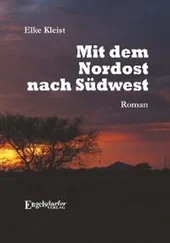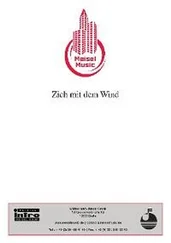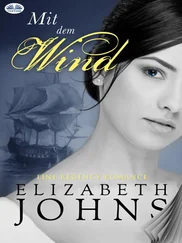Peter Strelzyk erinnert sich an Episoden aus seiner Kindheit und aus seiner Jugendzeit. »Da war zum Beispiel die Geschichte mit den Kartoffelkäfern, als ich noch zur Schule ging. Das war Anfang der 50er Jahre, ich war wohl zehn oder elf Jahre alt. Da hat man uns in der Schule beigebracht, die Amerikaner hätten aus Flugzeugen Kartoffelkäfer auf das Gebiet der DDR abgeworfen, um unsere Ernte zu vernichten. Wir sollten diese ›feindlichen Käfer‹ wieder einsammeln, um die Ernte zu retten.« Wahrscheinlich, so meinte er, hatten die Funktionäre das nur erfunden, um den Arbeitseifer der Schüler anzustacheln. Dennoch – die ersten Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Lehrer und Funktionäre waren geweckt.
Als Jugendlicher hat Peter Strelzyk andere Schlüsselerlebnisse. »Ich war Lehrling und hatte gerade eine neue Nietenhose aus dem Westen bekommen, ein kostbares Geschenk, das ich stolz meinen Freunden vorführte. Wir standen in einer Gruppe von jungen Leuten auf dem Marktplatz in Pößneck, als einige Volkspolizisten herankamen, uns als ›Halbstarke‹ beschimpften und mit zur Wache schleppten. Dort wurden die westlichen Markenzeichen aus unseren Hosen herausgetrennt.«
Damals, Ende der 50er Jahre, sei in der DDR der streichholzkurze »Ami-Haarschnitt« verboten gewesen. Ein paar Jahre später, zur Zeit der Beatles, wurden langhaarige Jugendliche von der Vopo festgehalten und mitten auf dem Marktplatz auf bereitstehende Stühle gesetzt. Dann seien zwei Friseure gekommen und hätten ihnen die langen Haare kurzgeschnitten. »Die Leute standen schweigend herum«, erzählt Peter Strelzyk, »kaum einer hat etwas gesagt. Die meisten fanden dieses Schauspiel offensichtlich entsetzlich, diese brutale Demonstration staatlicher Gewalt. Ein älterer Mann sagte laut: ›Das sind doch Nazi-Methoden.‹ Er wurde davongejagt.«
Während seiner Ausbildungszeit bei der Volksarmee und schließlich im Beruf seien ihm die ständigen Versammlungen, Veranstaltungen und Kundgebungen der SED, bei denen Erscheinen Pflicht war, »ganz schön auf den Wecker gefallen«. Peter Strelzyk sagt: »Ich habe schließlich geradezu allergisch auf Worte wie ›Kampfziel, Kollektiv, Brigaden, freiwillige Plan-Übererfüllung‹ reagiert. Sozialismus«, so sagt er, »mag eine große und wichtige Sache sein, aber in der DDR wird dieses Wort so oft im Munde geführt und für jeden Quatsch mißbraucht, bis es einen üblen Beigeschmack bekommt.«
Nach einiger Zeit habe er so gelebt wie die meisten seiner Freunde und Kollegen in Pößneck – nach außen hin angepaßt, sogar arriviert, aber mit einer heimlich wachsenden Wut und mit vorsichtigem Widerstand. Immer häufiger habe er die an jedem zweiten Dienstag im Monat stattfindende Betriebs-Parteiversammlung geschwänzt, obwohl das Erscheinen »sozialistische Pflicht« gewesen sei. »Einmal bin ich rausgegangen, als der Parteisekretär zum x-ten Male verkündet hat: ›Um die Erfordernisse des Sozialismus zu erfüllen, ist es notwendig, unsere Produktionsanlagen weiter zu automatisieren, damit wir im friedlichen sozialistischen Wettbewerb den Wohlstand unserer sozialistischen Bevölkerung weiterhin heben können.‹«
Als ihm auf der Bühne des Pößnecker Kreiskulturhauses die Urkunde als »Verdienter Aktivist« überreicht wird, sei ihm »das ganze Brimborium drumherum schon peinlich gewesen«, sagt Peter Strelzyk. »Ich habe mich vor den Kollegen im Saal geschämt, weil die genau wie ich wußten, was das für ein Propaganda-Theater ist, das zu immer mehr Arbeit und zu immer weiteren Plan-Übererfüllungen anspornen soll. Ich bin mir da als komischer Held vorgekommen.«
Zusammen mit einer Handvoll Kollegen verläßt Peter Strelzyk 1968 aus Protest eine Betriebsversammlung der Partei, als dort der Einmarsch der DDR-Truppen in die Tschechoslowakei gerechtfertigt wird. Dann beschwert er sich energisch über gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen im VEB Polymer. »In einer Abteilung mußten sechs Frauen in einem fensterlosen Raum arbeiten, in dem hochgiftige Lackverdünnungen gelagert wurden.« Man habe ihm gesagt, das sei nicht so schlimm, er übertreibe furchtbar, daran könne der Betrieb nichts ändern – bis alle sechs Frauen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert werden mußten.
Auch Peter Strelzyk wird krank. »Mir wurde die Gallenblase rausoperiert, und der Arzt sagte mir nachher vertraulich, daß ich ebenfalls über zu lange Zeit Giftstoffe eingeatmet hätte, weil wir über keine ausreichenden Entlüftungsanlagen verfügten.« Er habe sich auch jedesmal entmündigt gefühlt, wenn immer wieder das ganze Kollektiv oder die ganze Brigade oder der ganze Betrieb »freiwillig« schriftliche Planversprechungen an die Parteileitung abliefern mußte: »Lieber Genosse Erich Honecker, die Unterzeichnenden des VEB Polymer verpflichten sich auch in diesem Jahr wieder ...«
Schriftliche Distanzierungen von »Klassenfeinden« hätten genauso zum SED-Parteiprogramm gehört: »Die meisten von uns hatten noch nie etwas von Wolf Biermann gehört, aber wir mußten alle unterschreiben, daß wir sein Verhalten aufs schärfste verurteilen; ebenso war es später bei Rudolf Bahro.«
Wer sich weigert, wird nicht befördert, bekommt im Urlaub keine Reisegenehmigungen fürs sozialistische Ausland, erhält keine neue oder größere Wohnung. Trotz aller Verheißungen von einer Steigerung des Lebensstandards in der DDR gibt es heute eher mehr Versorgungsprobleme als vor einigen Jahren. Zum dreißigsten Jahrestag der Republik wird Spott verbreitet: »Früher ging es uns gut, heute geht es uns besser – wir möchten, daß es uns wieder gutgeht...«
Dreißig Jahre nach Kriegsende kommt es immer noch vor, daß kaum Socken oder Herrenunterwäsche, nur selten Fisch und nur wenig gutes Fleisch zu haben sind; Baumaterial ist oft nur mit Schmiergeld, und auch dann erst nach monatelangem Warten, zu bekommen.
Der gut verdienende »Verdiente Aktivist« fühlt sich um den Lohn seiner Arbeit betrogen: »Der Lohn ist doch so etwas wie eine Bescheinigung für geleistete Arbeit. Wenn ich diese Bescheinigung vorlege und dafür nicht das bekomme, was ich haben will, dann habe ich doch wohl umsonst gearbeitet.« Warum es eigentlich im Westen all das zu kaufen gäbe, was in der DDR noch immer Mangelware sei, habe er mal einen Parteifunktionär gefragt. Die verblüffende Antwort: »Die Kapitalisten lassen es den Arbeitern doch nur deshalb so gut gehen, damit die nicht merken, wie sie ausgebeutet werden.«
Mißmutig, immer mehr resigniert, vergräbt sich Peter Strelzyk in seine Arbeit. Wann immer er kann, drückt er sich vor offiziellen Veranstaltungen, auch vor der kollektiven Fröhlichkeit bei den beliebten bunten Abenden. Er meidet Gespräche im größeren Kreis, »weil es doch immer auf dieselbe optimistische Lobhudelei für das System hinausläuft«. Keiner traue sich, seine ehrliche kritische Meinung zu sagen. »Du weißt ja nicht, ob neben dir einer steht, der das dem Staatssicherheits-Dienst meldet oder der gar selber ein Mitarbeiter vom Stasi ist.«
Für ihn und seine Familie wird das Haus am Altenburgring zu einer Art Fluchtburg. »Wenigstens zu Hause konnte ich tun und lassen, was ich wollte, und offen aussprechen, was ich dachte.« Bei vielen seiner Kollegen hat Peter Strelzyk ebenfalls »einen systematischen Rückzug ins Privatleben beobachtet. Die ziehen die Wohnungstür hinter sich zu und schalten in der guten Stube das West-Fernsehen ein.«
In der kleinen Stadt Pößneck am Rande des Thüringer Waldes sind die hohen Fernsehantennen auf den Dächern auf »Westempfang« eingestellt. Der Blick durch die Mattscheibe in den anderen Teil Deutschlands ist für die meisten Qual und Verlokkung zugleich. »Es ist«, sagt Peter Strelzyk, »als ob man hungrig vor einem gedeckten Tisch sitzt und nicht ans Essen darf.«
Irgendwann – »Anfang 1975 muß es gewesen sein« – habe er zum erstenmal über Flucht gesprochen. »Ich weiß nicht mehr den Anlaß, ich habe jedenfalls zu Doris gesagt: ›Was hältst du davon, wenn wir in den Westen abhauen würden?‹«
Читать дальше