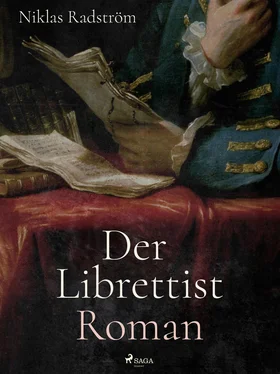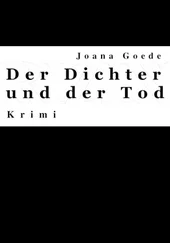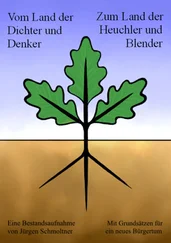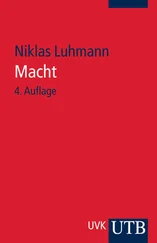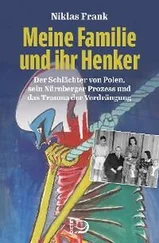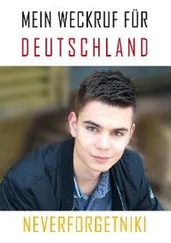Niklas Rådström - Der Librettist
Здесь есть возможность читать онлайн «Niklas Rådström - Der Librettist» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Der Librettist
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Der Librettist: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Der Librettist»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Der Librettist — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Der Librettist», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Matilda. Meine Enkelin. Viele Jahre lang erleuchtete sie mein Heim mit ihrer Schönheit, Lebensfreude und ihrem Talent. Im Alter von vierzehn konnte sie den gesamten dritten Gesang unserer geliebten Divina Commedia auswendig. Drei Jahre später war auch sie tot. Nichts ist so schmerzlich wie der Verlust eines Kindes oder eines geliebten Enkels, nichts stellt den Sinn des Lebens mehr in Frage. Die Kinder und Enkel, die ich um mich habe, erhellen meine Tage, während die, die ich verloren habe, ihre Schatten dazwischen werfen. Nicht einmal der sonnigste Sommertag kann diese Schatten vertreiben. Ich fürchte ständig, dass meine Liebsten vor ihrer Zeit ihres Lebens beraubt werden.
Ein Adoptivkind habe ich ins neue Land mitgenommen. Ich habe viel Kraft in seine Erziehung gesteckt und wage daher zu hoffen, dass es trotz seiner schwierigen Kindheit zu einem geachteten Mitbürger heranwachsen wird. Das adoptierte Kind ist die Kunst der Oper und ich fühle mich ihm so nah, dass ich mich kühn als einen seiner leiblichen Väter bezeichne. Gott weiß, dass dieses Kind mir grenzenlose Freude, aber auch tiefen Kummer bereitet hat. Nichtsdestotrotz liebe ich meine Nachkommen mehr als mein eigenes Leben. Als dieses allerliebste meiner Adoptivkinder nach jahrelangem Warten endlich in Amerika ankam, war dies einer der glücklichsten Momente meines Lebens. An jenem Tag, dem sechsten November 1825, als Manuel Vicente García an Land stieg, hatte seine Kompanie bereits ganz Europa erobert. Nun fehlte bloß noch die Neue Welt. Ich sehe sein Gesicht bei unserem ersten Treffen vor mir, als wäre es gestern. Er begann sofort mit den Proben im damals einzig echten Theater New Yorks, dem Park Theatre. Unter den mitgebrachten Sängern waren sein Sohn, der ebenfalls Manuel hieß, und die wunderbare Maria, seine junge Tochter, deren Stimme frei wie eine Lerche durch den Laubwald der Partituren flog. Das einfache Orchester, das sie zusammengetrommelt hatten – noch immer gab es nur einen brauchbaren Oboisten auf unserem Kontinent, und dieser war in New Orleans gestrandet –, stimmte gerade die Instrumente und versuchte, ihren Klang zu einem reifen Ganzen zu vereinen, als ich ankam und mich dem Maestro vorstellte. Wie sein Gesicht zu strahlen begann! Er schloss mich in die Arme und führte mich tanzend durch den Raum, während er Don Giovannis Champagnerarie Fin ch’han dal vino sang. Meine Worte, Amadeos Töne und Garcías brillante Stimme. So wurden wir Freunde.
Ich setzte sofort alle Hebel in Bewegung, damit der erste große Coup der Opernkunst in unserem wilden Kontinent mit Erfolg gesegnet sei. Alle Freunde, die ich im Lauf der Jahre gewonnen hatte – gebildete, einflussreiche Leute, die jedoch keinerlei Kenntnis der italienischen Oper besaßen –, versuchte ich auf die Schnelle in den Grundlagen der Oper zu unterrichten. Ich brachte ihnen den Unterschied zwischen einer Arie und einem Rezitativ bei und zeigte ihnen, wie Dichtung und Musik in ihrer szenischen Vereinigung auf der Bühne eine ganze Welt erschufen, die Zeit anhielten oder in einem Taktwechsel ganze Jahrhunderte übersprangen. Ich versuchte, ihnen die Angst vor der fremden Sprache zu nehmen, indem ich ihnen versicherte, dass die Pracht meiner Muttersprache die einfache ebenso wie die komplizierte Melodie veredelt und mit ihr zu einer Legierung aus Mitgefühl und Liebe verschmilzt. Eine Klatschkolumnistin legte ihnen nahe, wie sie sich kleiden und benehmen sollten, um den Ansprüchen eines Opernabends gerecht zu werden – passenderweise unter dem Pseudonym Aschenputtel. Sie betonte, dass es in der europäischen Oper obligatorisch sei, die eleganteste Festkleidung zu tragen. Wer als Dame auffallen wolle, solle besonderen Wert auf hochgestecktes Haar und Dekolletéschmuck legen. Von Federschmuck und breiten Musselinkragen solle man jedoch Abstand nehmen, und die Männer sollten allzu grell gemusterte Krawatten und Hüte meiden.
Als ich dann, nur elf Tage, nachdem García und seine Kompanie in Manhattan an Land gestiegen waren, in der ersten Vorstellung von Rossinis Barbier von Sevilla saß – die mir von allen Opern, deren Libretto nicht aus meiner Feder stammt, die liebste ist –, war es, als wären die Bildung, die gute Erziehung und die Moral der Alten Welt endlich auch in der Neuen angekommen. Die angesehensten Familien New Yorks waren anwesend, sogar der Bruder des Kaisers. Mein Freund, der Dichter Fitz-Greene Halleck, stellte mich dem Schriftsteller James Fenimore Cooper vor. Halleck war Mitglied des sogenannten Ugly Club , der sich der Verbreitung aller möglicher Unschönheit verschrieben hatte, selbst jedoch ein gut aussehender junger Mann mit einem ausgeprägten Gespür für die edlen Werte seiner Sprache. Die Damen trugen die bezauberndsten Kreationen, zurückhaltend und aufreizend zugleich in ihrer Eleganz. Aber nichts von alledem, keiner der von aller Munde geflüsterten Namen, keine weibliche Haarpracht, kein seidengeschmücktes Dekolleté, keiner der reichen, mächtigen Männer, die wie Fürsten durch die Menge schritten, konnte sich mit dem Augenblick der plötzlich eintretenden Stille messen, mit der Spannung, als die Musiker ihre Instrumente stimmten und der Maestro die ersten Takte der Ouvertüre schlug. García dirigierte selbst, wenn er nicht in der Titelrolle auf der Bühne stand. Diese Freiheit, diese Seligkeit, diese Anteilnahme an allem Lebendigen! Mir stiegen Tränen in die Augen, und durch diesen Schleier sah ich sie auftreten: Figaro und Rosina, Graf Almaviva und Doktor Bartolo. Liebe, alte Freunde, die ich für immer verloren geglaubt hatte, standen wieder vor mir und hießen mich, nur mich, aufs Neue willkommen in ihrem Kreis.
Musik. Dieser Atemspender des Lebens, wie natürlich sie dem Schlag des Herzens folgt, wie sie in uns den wahren Menschen erkennt. Dass ich das noch einmal erleben durfte, gab meinem Leben wieder Sinn. Die Rückkehr der Musik vergoldete im Nachhinein die langen Tage des Wartens in meiner Buchhandlung, in die sich nur wenige Kunden verirrten. Auch die folgenden Monate hielt sie mich am Leben, auch wenn der Reiz des Neuen langsam verschwand und das Interesse der Öffentlichkeit Woche für Woche schwächer wurde. Schon die Premiere des Barbiers rief die eine oder andere entsetzte Reaktion hervor. Unser höchster Richter, Kanzler Kent, verließ schimpfend das Theater. Die italienische Oper sei eine Verunglimpfung der menschlichen Natur. Verunglimpfung! Dabei zeigt sie uns bald, wie wir sind, und bald, wie wir sein sollten – das ist das Wesen der Dichtung, und von ihr sollte der Mensch lernen. Neun Monate, ebenso lang wie ein Kind den Schutz des Mutterleibes braucht, um ein lebenstauglicher Mensch zu werden, blieb García mit seiner Kompanie bei uns. Da ich mit Hilfe meiner Freunde und Studenten genügend Mittel gesammelt hatte, um Don Ottavios Rolle mit einem guten Sänger zu besetzen, wurde endlich der größte Wunsch meiner alten Tage erfüllt: Don Giovanni auf einer amerikanischen Bühne zu erleben, gesungen in den italienischen Versen, die ich vor vielen Jahren in Wien drucken ließ – unter den gleichen Mühen und Wehen, aber auch mit dem gleichen Glücksgefühl, das eine Mutter bei der Geburt ihres Kindes verspürt. Ich saß im Saal wie ein Mann, der gerade erwacht und sich in einem seiner schönsten Träume wiederfindet.
Und dann reisten sie ab, García und seine Freunde. Die Abende zu Beginn ihres Engagements, die bis zu zweitausend Dollar einbrachten, waren längst vorbei. Nun konnte es sein, dass man nach einer spärlich besuchten Vorstellung mit fünfundzwanzig Dollar dastand. Also zogen sie weiter nach Mexiko, mit Kostümen und Bühnendekoration, Sängern und Musikern, um dort ihr Glück zu versuchen. Das verlangt das Theater von seinen Dienern: ein Leben in ständiger Rastlosigkeit, immer unterwegs. Wie ich hörte, habe ich auch García überlebt. Offenbar hatte er Erfolg in Mexiko, aber nach der Rückkehr nach Europa verlor er sein gesamtes Vermögen. Wie, weiß ich nicht. In seiner Not nahm er Gesangsschüler an, und seine Kinder arbeiteten als Bühnenhelfer. Nun ist auch García tot. Und ich war, nachdem er New York verlassen hatte, wieder allein mit meiner Sehnsucht nach Musik.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Der Librettist»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Der Librettist» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Der Librettist» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.