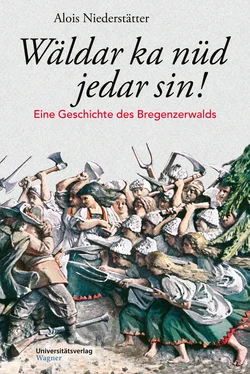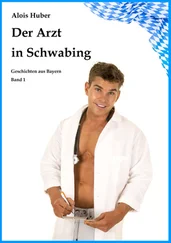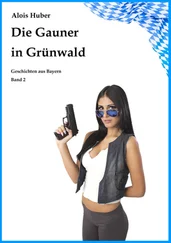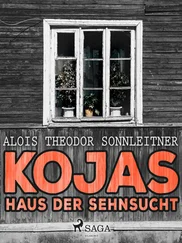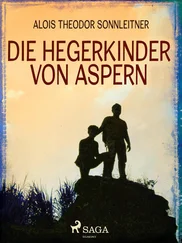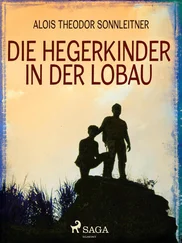Einen Höhepunkt erlebte das Trachtenwesen, als sich im ausgehenden 19. Jahrhundert die Volkskunde und die Heimatschutzbewegung seiner annahmen und aus ihm einen »gesunden« Gegenpol zu den rasch wechselnden Moden der »dekadenten« Großstädte machten. Davon wusste auch der damals rasch zunehmende Tourismus zu profitieren. Wenige Jahrzehnte später spannten der »Ständestaat« und in weiterer Folge das NS-Regime die Tracht als Mittel der politischen Inszenierung vor ihren Karren.

Diese Ideologisierung ließ das Trachtenwesen nach 1945 als »belastet« erscheinen, zumal der Begriff »Heimat« überhaupt brüchig geworden war und es noch lange bleiben sollte. Dazu kamen die vom Zweiten Weltkrieg verursachten Verwerfungen und der wirtschaftliche, soziale sowie kulturelle Wandel, der auch den Bregenzerwald erfasste.
In den letzten Jahrzehnten erlebte die Bregenzerwälder »Juppe« als durchaus kostspieliges Festtagskleid aber eine regelrechte Renaissance. Das auch in anderen Landesteilen verwendete Wort stammt aus dem Romanischen (französisch »la jupe« für Rock, italienisch »giubba« für Jacke, auch das deutsche Lehnwort Joppe hat denselben Ursprung). Es bezeichnet den vom Typus her seit der frühen Neuzeit im ganzen Alpenraum verbreiteten »Tragmiederrock«, bei dem Rock und Mieder zu einem Kleid vernäht sind. Charakteristisch für die wohl in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts zurückreichende Bregenzerwälder Ausprägung ist der plissierte und gesteifte Rock aus schwarzem Glanzleinen, der an das spanische Hofkleid der Barockzeit erinnert und die Juppe zum festlichen Kleidungsstück »besserer« Kreise machte. Für den Alltag sowie für die ärmere Bevölkerung gab es eine einfache, ungestärkte Variante.
Bildliche Darstellungen seit dem 18. Jahrhundert, darunter zwei Selbstportraits der berühmten, väterlicherseits aus Schwarzenberg stammenden Malerin Angelika Kauffmann, zeigen jene Bestandteile, die mit zahlreichen Modifikationen bis heute verwendet werden: so etwa den »Blätz«, einen bestickten Brustlatz, die Spitzhaube aus Fell oder – exklusiv für ledige Frauen – das »Schapel«, ein Krönchen aus Goldfäden und -plättchen. Bis etwa 1800 war das bis zur Taille reichende Mieder rot. Aufwändige Zierelemente brachte der Stickereiboom mit sich, wie der Krumbacher Pfarrer Brändle 1829 beklagte: »Die Kleiderpracht nahm überhand, indem man sich mit der einfachen Leib- und Kopfbedeckung, dem zierlosen Gürtel und unverbrämten Brustlätzen der Alten nicht mehr begnügte, sondern so viel möglich alles mit Seide, Silber und Gold behangen sein mußte«. Der im Sommer getragene schwarze Strohhut ist ebenso eine »Erfindung« des späteren 19. Jahrhunderts wie die »Jungfernjuppe« aus weißer Baumwolle als historisierende »Rekonstruktion« jener Kleidung, die die Wälderinnen in der Sage von der Schlacht an der »Roten Egg« getragen hätten. Historisch belegt ist, »dass die Juppe des 17. Jahrhunderts aus Leinwand war […]. Rohfarbig, durch oftmaliges Waschen in Aschenlauge aufgehellt, wird man sie sich in hellen Grautönen vorstellen dürfen« (Paul Rachbauer).

Selbstporträts der berühmten Malerin Angelika Kauffmann in heimatlicher Tracht.
Angesichts des ausgeprägten Talschaftsbewusstseins erstaunt es nicht, dass der Bregenzerwald heute die einzige wirklich aktive Trachtenlandschaft Vorarlbergs ist, Wenn es um einen so augenfälligen Ausdruck von Zugehörigkeit geht, können Emotionen nicht ausbleiben – vom Hüten echter oder vermeintlicher Originalität über die grundsätzliche Frage, wer zum Tragen der Tracht berechtigt sei, bis hin zur zwar gut gemeinten, aber irrigen Vorstellung, es handle sich um die älteste ihrer Art im ganzen Alpenraum.

Trachteninszenierung im Jahr 1939.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.