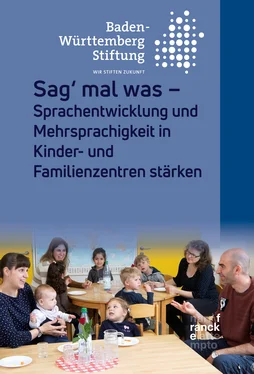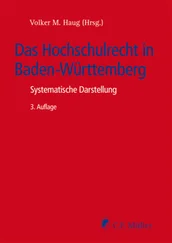Die Arbeit der beteiligten KiFaZe wurde von der wissenschaftlichen Begleitung inhaltlich unterstützt und prozessbegleitend evaluiert. Die wissenschaftliche Begleitung stellte somit eine prozessorientierte Hilfestellung für die Einrichtungen dar und war von Anfang an in den Prozess der Maßnahmenentwicklung mit einbezogen.
Die Unterstützung der wissenschaftlichen Begleitung für die KiFaZe umfasste eine Bestandsaufnahme sowie Maßnahmen der Qualifizierung und der Organisations- und Teamentwicklung. Die Maßnahmen bezogen sich zum Teil auf die einzelnen Einrichtungen, zum Teil wurden sie aber auch einrichtungsübergreifend ausgerichtet. Durchgeführt wurden bspw. in jedem KiFaZe ein Teamtag mit Zukunftswerkstatt, KiFaZ-teamübergreifende Qualifizierungstage und Coaching.
Außerdem wurde eine prozessbegleitende Evaluation durchgeführt. Die Aktivitäten und Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung sind in dem Beitrag von Jutta Sechtig, Tamara Schubert und Susanna Roux dargestellt (Kap. 5). Sie wurden auf der Abschlussveranstaltung im September 2019 präsentiert, auf der auch die am Projekt beteiligten KiFaZe in praxisbezogenen Workshops rund um die Themen „Sprachliche Bildung“, „Teamentwicklung“ und „Vernetzung im Sozialraum“ Beispiele aus ihrer Arbeit vorstellten und zum Erfahrungsaustausch einluden.
Abbildung 3:
Austausch bei einem KiFaZ-Treffen

Bedingt durch die Auswahlmodalitäten und -kriterien sind die KiFaZe bereits von einem hohen Niveau aus gestartet. Sie waren engagiert und hoch motiviert sowie bereit, gewohnte und liebgewonnene Herangehensweisen immer wieder infrage zu stellen und infrage stellen zu lassen. Dies verdeutlicht auch ein Zitat aus dem Projekt: „Wir dachten, wir sind da schon weit – aber das ist ein Thema, über das man immer wieder einmal nachdenken muss.“
Im Rahmen des Projekts haben die KiFaZe verschiedene Maßnahmen zur sprachlichen Bildung und zur Förderung von Mehrsprachigkeit entwickelt und umgesetzt. Auf sie wird hier nicht weiter eingegangen, da sie im vorliegenden Band zum einen von den KiFaZen selbst kurz berichtet werden (Kap. 3) und zum anderen in dem Kapitel „Aus der Praxis für die Praxis“ (Kap. 4) von Anja Bereznai in Zusammenarbeit mit den Projektverantwortlichen in den KiFaZen ausführlich dargestellt sind.
Prägend für die Zusammenarbeit im Projekt – sowohl innerhalb als auch zwischen den KiFaZen – waren gegenseitige Unterstützung, vertrauensvolles Miteinander, gemeinsames Lernen und Wachsen, konstruktive Kritik und Kritikfähigkeit.
1.1.6 Aufbau der Publikation
Die Publikation richtet sich an eine breite Zielgruppe, unter anderem Pädagoginnen und Pädagogen in der Praxis, Leitungen von Kitas, KiFaZen und Familienzentren, Studierende und Lehrende an Fachschulen für Sozialpädagogik und Pädagogischen Hochschulen sowie Aus- und Weiterbildungspersonal. Sie beinhaltet sowohl wissenschaftliche als auch praxisorientierte Beiträge und wurde von Expertinnen und Experten aus Bildungsverwaltung, Wissenschaft und Praxis verfasst. Dies spiegelt sich auch im Aufbau der Publikation wider.
Im nachfolgenden Kapitel 1.2 stellt Jana Ellwanger vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg das Landesförderprogramm „Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Kinder- und Familienzentren“ vor.
Kapitel 2 besteht aus zwei wissenschaftlichen Beiträgen: In Kapitel 2.1 widmet sich Jens Kratzmann von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt dem Thema „Unterstützung (mehr)sprachlicher Entwicklungsprozesse in der Kindertageseinrichtung“ und stellt grundlegende Diskussionslinien zur Unterstützung der (mehr)sprachlichen Entwicklung von Kindern in Kindertageseinrichtungen vor. In Kapitel 2.2 eröffnet Stefan Faas von der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd „Sozialräumliche Perspektiven auf sprachliche Bildung und Förderung von Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen“ und zeigt die Potenziale von Familienzentren auf.
In Kapitel 3 stellen sich die drei KiFaZe vor, die während der gesamten Projektlaufzeit am Projekt SuMi-KiFaz teilgenommen haben. Das Katholische Kinder- und Familienzentrum St. Martin in Ludwigsburg, das Familienzentrum Schillerstraße in Heilbronn und das Katholische Kinderhaus St. Theresia in Mannheim geben Einblicke in ihre jeweiligen strukturellen Merkmale, ihre Ausgangsbedingungen, ihre Schwerpunkte und die einrichtungsspezifischen Entwicklungen während des Projekts.
Kapitel 4 steht ganz unter dem Motto „Aus der Praxis für die Praxis“. Anja Bereznai vom Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg stellt – gemeinsam mit den Projektverantwortlichen aus den KiFaZen – eine Vielzahl praktischer Beispiele vor, die Ideen für die sprachliche Bildung und die Förderung von Mehrsprachigkeit geben.
In Kapitel 5 berichten Jutta Sechtig, Tamara Schubert und Susanna Roux – alle von der Pädagogischen Hochschule Weingarten – von den Aktivitäten und Erkenntnissen der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts SuMi-KiFaz .
Im abschließenden Kapitel 6 adressiert Anja Bereznai die entscheidende Frage „Was bleibt nach drei Jahren SuMi-KiFaZ ?“ Im Rahmen des Projekts wurden vielfältige Faktoren identifiziert, die das Gelingen der (Sprach-)Arbeit der Einrichtungen beeinflussen. Basierend hierauf leitet Anja Bereznai für verschiedene Ebenen Implikationen für die Praxis ab, unter anderem für Pädagoginnen und Pädagogen, für die Leitung und für die (Weiter-)Qualifizierung. Diese Implikationen geben wichtige Hinweise für alle, die Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit in KiFaZen voranbringen wollen.
Albers, T., Bereznai, A., Dintsioudi, A., Hormann, Jungmann, T., Koch, K., Kwaśnik, N., et al. (2017). Sprachliche Bildung und Förderung aus interdisziplinärer Perspektive. In A. Bereznai/nifbe (Hrsg.), Mehr Sprache im frühpädagogischen Alltag (S. 13-25). Freiburg: Herder.
Amirpur, D. (2019). Inklusionsorientierte Bildung mit Familien in der Migrationsgesellschaft. In T. Geisen, C. Iller, S. Kleint, & F. Schirrmacher (Hrsg.), Migrationssensible Familienbildung. Ein interdisziplinäres Forschungsfeld (S. 67-80). Münster: Waxmann.
Baden-Württemberg Stiftung (Hrsg.) (2011). Sag’ mal was – Sprachförderung für Vorschulkinder. Tübingen: Narr Francke Attempto.
Baden-Württemberg Stiftung (Hrsg.) (2014). Sag’ mal was – Sprachliche Bildung für Kleinkinder . Tübingen: Narr Francke Attempto.
Baden-Württemberg Stiftung (2016). Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit in Kinder- und Familienzentren stärken . Ausschreibung zum Projekt. Stuttgart: Baden-Württemberg Stiftung.
Beckerle, C. (2017). Alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten und in der Grundschule. Evaluation des „Fellbach-Konzepts“ . Weinheim: Beltz Juventa.
Beckerle, C., & Mackowiak, K. (2019). Adaptivität von Sprachförderung im Kita-Alltag. Ein Vergleich des Sprachförderhandelns pädagogischer Fachkräfte bei Kindern mit Deutsch als Erst- und Zweitsprache und unterschiedlichen Sprachkompetenzen. Lernen und Lernstörungen, 8 , 203-211.
Bruner, J. S., Watson, R., & Aeschbacher, U. (1987). Wie das Kind sprechen lernt . Bern: Huber.
Bundesverband der Familienzentren (2018). Positionspapier des Bundesverbandes der Familienzentren e.V. (BVdFZ) zum Thema Familienzentren . Verfügbar unter: www.bundesverband-familienzentren.de/positionspapier/(20.04.2020).
Buschmann, A., Degitz, B., & Sachse, S. (2014). Alltagsintegrierte Sprachförderung in der Kita auf Basis eines Trainings zur Optimierung der Interaktion Fachkraft-Kind. In S. Sallat, M. Spreer & C. W. Glück (Hrsg.), Sprache professionell fördern (S. 28-39). Idstein: Schulz-Kirchner.
Читать дальше