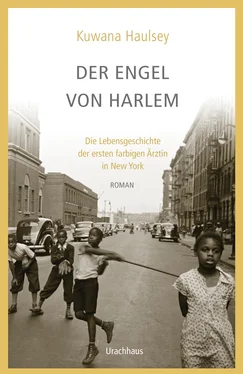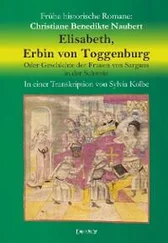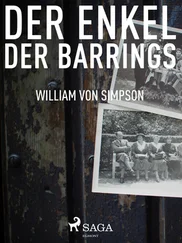Hinter einem Stapel von Säcken, die allem Anschein nach mit Hafer gefüllt waren, fand er einen Platz zum Verstecken. Da es zu eng war, um aufzustehen, kroch und krabbelte William zu der Stelle zurück, an der er seine Schwester gelassen hatte, und zog sie – auf den Knien rückwärts rutschend – hinter die Mauer aus Getreide. Er legte sein Ohr an ihren Mund und schwor, dass er, sollte er nichts hören, die Bodenklappe öffnen und das Licht hereinlassen würde. Dann gäbe es keinen Grund mehr, sich zu verstecken, keinen Grund mehr, noch länger davonzulaufen.
Als sie keuchte und murmelte: »Geh runter von mir, du Idiot. Was machst du?«, war William außer sich vor Glück.
»Halt die Klappe, dummes Ding«, flüsterte er und fiel an ihrer Schulter vom einen Moment auf den anderen in einen tiefen Schlaf.
Das Knarren der Bodenklappe weckte sie auf. Gelbes Kerzenlicht drang auf den Boden und kroch über Säcke und Kisten.
»Was ist da unten?«
Williams Hand legte sich schnell auf Fannys Mund. Nicht bewegen . Er hauchte die Worte in ihr Ohr, und obwohl sich ihr Körper anspannte und bebte, gab sie kein Geräusch von sich.
»Hier sind nur Vorräte, Dr. Wheeler. Wenn Sie wollen, seh ich mir am Morgen mal an, was es hier alles gibt, Sir.«
»In Ordnung. Aber mach das auf jeden Fall, bevor Colonel Corse hier durchkommt.«
»Jawohl, Sir«, sagte die junge Stimme und machte die Klappe wieder zu.
Die Dunkelheit schlängelte sich durch Williams Kopf, schnitt in seine nackten Fußsohlen und lachte. Lachte die ganze Zeit. Nur der Druck von Fannys Körper gegen seinen eigenen hielt ihn davon ab, sich an die Steine zu kauern und zu schreien.
»Fanny, steh auf. Wir müssen hier abhauen.«
»Willie, ich kann mich nicht bewegen. Ich schwöre bei Gott – ich kann nicht.«
William tastete im Dunkeln nach ihrem Bein. Es war hart und auf mehr als den doppelten Umfang angeschwollen. Er konnte spüren, wie ihr Körper sich aufbäumte, als sie versuchte, beim Weinen keinen Laut von sich zu geben.
»Oh bitte, Gott, bitte. Willie, fass es nicht an. Bitte nicht.«
»Fanny, ich weiß nicht, was ich machen soll.«
»Lauf weg, Willie«, hauchte sie. »Du musst hier weg. Du kannst nicht hierbleiben. Sie bringen dich um.«
»Hör auf, Fanny!«
»Aber was soll ich denn ohne dich machen? Wenn du wegrennst, kannst du wenigstens später zurückkommen und mich holen, und dann können wir gemeinsam nach Norden gehen. Wenn du tot bist, kann ich nirgendwo hingehen.«
Das brachte William dazu, innezuhalten und nachzudenken. Aber trotzdem schüttelte er den Kopf, und weil es zu dunkel war und Fanny nichts sehen konnte, sagte er nochmals laut: »Nein.«
Fanny erwiderte nichts. William hörte sie neben sich atmen, und er wusste, dass sie nicht schwieg, weil sie einverstanden war, sondern weil die Schmerzen zu groß waren. Er wusste außerdem, dass ihre Wangen, sollte er sie berühren, nass waren. Er rieb ihre Schulter mit der Handfläche und legte seinen Kopf an ihren Hals; unter ihrer Haut konnte er das Blut rauschen hören. Das Geräusch machte ihn müde und er fiel in einen unruhigen Schlaf.
Er träumte von vieläugigen Kreaturen mit blutroten Lippen und Flügeln über dem Herz, und Fanny war auch dabei und gehörte zu ihnen. Er hörte sie »William, William, wach auf!« rufen, und als er erwachte, schrie er bereits.
Fanny schrie auch, sie hatte solche Schmerzen, dass seine Arme sie nicht festhalten konnten, und zunächst konnte William ihre eigenen Schreie gar nicht unterscheiden von dem wilden Gejohle und Gekreische, das von oben herabdrang.
Männer. Rundherum überall Männer, die auf dem Boden über ihren Köpfen umhergingen. William konnte Blut und Dreck riechen, und er konnte nicht aufhören zu schreien, weil er dachte, er würde auch ihren Schweiß riechen, und der roch, als wäre es sein eigener. Er wusste nicht, wo er war. Die Dunkelheit krähte triumphierend und pickte nach ihm, und er versuchte aufzustehen, versuchte wegzulaufen, doch er schaffte es nicht. Es gab nicht genug Platz. Sein Kopf schlug an die Bodenbretter über ihm, und da fiel ihm wieder ein, wo er war. Im Keller. Er kniete sich wieder hin, tastete im Dunkeln nach Fanny und nahm ihre Hand. Aber sie weinte und rief nach ihrer Mutter und Miss Frances. Sie nahm gar nicht wahr, dass er auch da war.
William ließ ihre Hand los und kroch weg, weil er nicht ertragen konnte, sie derart leiden zu hören. Er wusste, dass Master Benjamin ihm Vorwürfe machen würde. Seine Schuld. Alles war immer seine Schuld. William kroch unter die Bodenklappe, die Fäuste fest gegen die Vertiefung in der Mitte seines Oberkörpers gepresst, schaukelte vor und zurück, hörte Stimmen, hörte Worte und Namen, die gerufen wurden, für ihn aber keinerlei Sinn ergaben. Das Einzige, was klar zu ihm durchdrang, waren die Schreie und das deutlich hörbare Geräusch einer Säge, die sich durch etwas hindurchmühte, was William sich nur als Knochen ausmalen konnte.
Den ganzen Tag und eine weitere Nacht hielten sie sich im Keller versteckt. Fanny hatte jetzt Fieber, und es wurde immer schwerer, sie aufzuwecken. Als William sie nicht dazu bringen konnte, sich zu rühren, ließ er sie einfach, prüfte nur hin und wieder, wenn Sorge in sein Herz stach, ob sie noch atmete, und wischte ihr den Schweiß vom Gesicht. Ihm war lieber, sie wachte nicht so oft auf, da die schreienden und fluchenden Männer über ihren Köpfen ihr nur Angst gemacht hätten. Der Gestank nach Blut und wundem, verrottendem Fleisch verursachte ihr Übelkeit. Jedes Mal, wenn ein Stiefel auf die Bodenklappe krachte, dass sie klapperte, schlug sie jammernd ihren Kopf gegen den Sandstein. William musste sie unbedingt da rausbefördern.
Er versuchte, durch die Bodenritzen hindurch irgendwelche Neuigkeiten zu erhaschen, die ihm Hinweise darauf geben konnten, was er machen sollte. Aber von all dem Geschrei und Durcheinander über ihnen war nicht viel verstehen.
Die Unionstruppen hatten Groveton angegriffen (dort war Master Benjamin), und Männer starben in Flüssen und Wäldern, lagen ausgebreitet in Weizenfeldern oder zusammengekrümmt in Büschen, ohne Gesichter, ohne Herzen, ohne Beine. Es fehlte die Zeit, die Verwundeten zum Arzt im Stone-Haus in der Nähe der Sudley Road zu bringen. Dort gab es sowieso schon genug Tod. Mehr als genug. Der Arzt hier im Chinn-Haus musste reichen.
Weiches Blei erschüttert harten Knochen nun mal, und der Arzt musste so gut wie immer schneiden. Was soll mit den Armen und Beinen geschehen, Sir? William hörte den Arzt nie darauf antworten.
Dann setzte das Dröhnen ein – es klang, als sei das Haus von Donner umhüllt –, und William konnte hören, wie sich draußen die konföderierte Armee versammelte. Dass es Konföderierte waren, erkannte er an der Art, wie die Männer im Haus johlten und schrien. Die marschierenden Soldaten weckten Fanny auf, und William zog sie zu sich und hielt sie ganz fest. Sie wussten nicht mehr, ob es draußen Tag oder Nacht war, ob die Unionstruppen auf dem Vormarsch oder auf dem Rückzug waren. Das Einzige, was sie wussten, war, dass sie in der Falle saßen. Es war sogar möglich, dass Master Benjamin draußen vor dem Fenster stand und wartete. William hielt diese Ungewissheit nicht länger aus.
»Was sollen wir machen, Willie?«
»Ich glaub, ich seh mal nach, was da draußen los ist.«
»Nein, Willie. Du kannst nicht rausgehen. Die Männer töten dich. Lass es bleiben!«
»Ich geh ja nicht raus. Ich schau nur.«
Als Fanny zu wimmern anfing, legte William die Arme um ihren Nacken und sagte: »Schwesterherz, wir haben zu lange gewartet. Ich muss wissen, was los ist, sonst sind wir hier unten vielleicht für immer eingesperrt.«
Fanny antwortete nicht, lockerte aber ihren Griff um Williams Nacken, und er kroch zu dem Fenster, das zur Vorderseite des Hauses hinausging. William öffnete den Riegel und schob das Brett ein paar Zentimeter zur Seite. Rauch und Hitze und Licht drangen durch den Spalt und blendeten ihn, sodass er sich rasch wieder vom Fenster abwandte und fluchte. Aber gleich war er wieder zurück – und auch wenn Tränen aus seinem brennenden Auge liefen, presste er jetzt sein Gesicht fest an das Holzstück.
Читать дальше