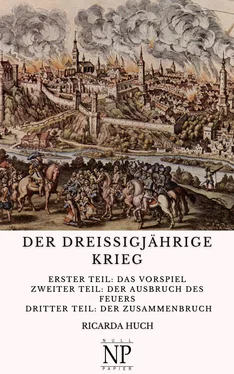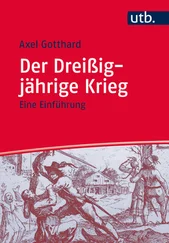Ricarda Huch - Der Dreißigjährige Krieg
Здесь есть возможность читать онлайн «Ricarda Huch - Der Dreißigjährige Krieg» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Der Dreißigjährige Krieg
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Der Dreißigjährige Krieg: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Der Dreißigjährige Krieg»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Der Dreißigjährige Krieg — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Der Dreißigjährige Krieg», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Damit man ihm desto weniger anhaben könne, ließ Schenkern die Spanier ins Land, die unter ihrem Feldherrn Mendoza mehrere Plätze besetzten und sich dort als rechtmäßige Herren gebärdeten. Einen Grund zu diesem unerhörten Schritt zog Schenkern daraus ab, dass er einen Plan der protestantischen Erbansprecher, sich in Besitz des Landes zu setzen, entdeckt habe und diesen habe zuvorkommen müssen. Ein Geschrei der vergewaltigten Gegend erfüllte bald das Reich, dessen Glieder denn auch zu erwägen begannen, was bei einem derartigen feindlichen Einbruch durch die Reichsgesetze vorgesehen sei. Diese nun legten die Pflicht, den Feind abzuwehren, dem nächstgelegenen Kreise auf, welches in diesem Falle der westfälische war, und derselbe setzte sich demgemäß in Beratung, wie das Kreisheer und das Geld, es zu besolden, zusammenzubringen sei. Da jedoch mehrere Monate darüber verliefen, während welcher die Spanier nach ihrer Weise Stadt und Land verwüsteten, traten einige Fürsten zusammen, um etwa von sich aus der feindlichen Eigenmacht zu steuern, die dem Reich zur Unehre gereiche und ihnen gefährlich sei. Es waren dies der Landgraf Moritz von Hessen, der Herzog Heinrich Julius von Braunschweig und der Pfalzgraf Kurfürst Friedrich IV., deren Länder dem Herzogtum Jülich nahe lagen und die überhaupt gewohnt waren, bei allen vorkommenden Reichshändeln Partei zu ergreifen.
Pfalzgraf Friedrich IV. fühlte sich für seine Person nicht anders wohl als bei den fürstlichen Unterhaltungen der Jagden, Turniere und Trinkgelage; aber er war sich bewusst, der Träger eines ruhmvollen Namens und Erbe von Fürsten zu sein, die sich durch kampfbereites Einstehen für ihre religiöse Überzeugung angesehen und gefürchtet gemacht hatten, und hielt darauf, die Überlieferungen seines Hauses fortzusetzen. Die blühende Pfalz sollte die Vormacht und Stütze der Reformierten im Reiche und eigentlich der Evangelischen überhaupt bleiben, da Sachsen anfing, eine träge und zweideutige Politik zu befolgen, um es mit dem Kaiser nicht zu verderben. Deshalb umgab sich Friedrich IV. mit reformierten Räten, die an seiner Statt unternehmend, ehrliebend und fleißig waren, hing ihnen dankbar an und unterwarf sich ihnen in allen Stücken, mit der Einschränkung, dass er sich ihrer unbequemen Herrschaft nicht selten entzog, um an befreundeten Höfen beim vollen Becher sich ihrer Ratschläge und Grundsätze gänzlich zu entschlagen. Auch seine Gemahlin, die Oranierin Luise Juliane, deren Herkunft die Verbindung mit ihr zum Zeichen für kühne, kampfbereite reformierte Sinnesart machte, hatte er wegen ihrer Bildung, ihres beherrschten Wesens und tüchtigen Charakters anfänglich geliebt und verehrt; auf die Dauer aber vermochte er ihre Überlegenheit, da sie eine Frau war, nicht zu ertragen und zeigte ihr die seinige durch rohe Behandlung, die sie mit Geduld und Würde ertrug; diese Art und Weise schien ihm aber Verachtung auszudrücken und gab daher seiner Erbitterung stets neuen Stoff.
Anders geartet war Landgraf Moritz von Hessen, ein schlanker, stattlicher, überaus tätiger und kluger Mann, von einer gewissen Feinheit und Ehrlichkeit des Denkens, sodass er, wie er selbst durch Unrat und Unordnung gestört wurde und sich stets gedrängt fühlte, in dunkle Winkel hineinzuleuchten, überall unbequem empfunden wurde, wo schmutzige oder stumpfsinnige Behaglichkeit waltete. Er war seit dem Jahre 1593 mit Agnes aus dem gräflichen Hause Solms-Laubach verheiratet, die wegen ihrer Schönheit mit der Göttin Venus verglichen wurde und diese Gabe den Kindern vererbte, die sie ihm gebar.
Dagegen hielt der Herzog von Braunschweig am Alten fest, aber wie der Landgraf war er dem Müßiggang feind und dazu von so ausgezeichneter Gesundheit, dass das Trinken ihn nicht vom lebhaften Betrieb und vielfacher Tätigkeit abhielt. Diese beiden Herren gerieten leicht aneinander, weil ein Streit zwischen ihnen schwebte, indem der Herzog auf mehrere Ämter Anspruch erhob, die der Landgraf als sein Eigentum ansah und stets angesehen hatte und in deren Besitz er sich, rechtlicher Entscheidung vorgreifend, gewaltsam gesetzt hatte. Davon abgesehen, reizten den Landgrafen des Herzogs breite Gemütlichkeit, sein selbstgefälliges Behagen, seine altväterischen Sitten und die Langsamkeit seines Verstandes; den Herzog dagegen ärgerte das neuerungssüchtige Wesen des Landgrafen, das er unfürstlich fand, seine Redefertigkeit und Überlegenheit, wie er denn das Gefühl hatte, als schlage der Landgraf seine, des Herzogs, weltberühmte Gelehrsamkeit gering an. Allerdings dachte der Landgraf diesbezüglich, der Herzog sei ein Fass voll Sauerkraut, es sei wohl viel darin, aber geringe, grobe Nahrung. In der Politik war Herzog Heinrich im Grunde der Meinung, die Dinge wären gut, wie sie eben wären, und das alte Römische Reich, wie es nun einmal sei, dürfe durchaus nicht angetastet werden; da er aber darauf erpicht war, die Stadt Braunschweig, die sich als Reichsstadt gebärdete, sich untertänig zu machen, und der Kaiser in diesem Zwist kürzlich gegen ihn und zugunsten der Stadt entschieden hatte, schloss er sich mit zähem Nachdruck den Fürsten an, die es antikaiserlich trieben.
Bevor es zu einer gemeinsamen Beratschlagung kommen konnte, musste der zwischen dem Landgrafen und dem Herzog schwebende Streit wegen der Ämter in etwas beigelegt werden, was der Pfalzgraf über sich nahm; dann traten die Herren der Sache näher unter einer starken Rede des Herzogs Heinrich Julius, wie schimpflich der spanische Einfall für das Reich sei. Wenn es nicht Spanien wäre, meinte Hessen, würde der Kaiser sich eher rühren, wie träge er auch sei. Nun, man müsse eben selbst handeln, sagte Heinrich Julius, und da sie einmal so weit einig wären, solle das Unwesen bald ein Ende nehmen. Als es daran ging, das Heer zusammenzubringen, das die Spanier vertreiben sollte, zeigten sich jedoch vielerlei Schwierigkeiten in Bezug auf die Anzahl der Truppen und wie sie auf jeden zu verteilen wären; denn es wollte jeder so wenig wie möglich besolden. Am Ende, meinte Moritz von Hessen, könne man sich so helfen, dass man es den Holländern überlasse, die Spanier zu vertreiben, und sie nur mit Geld dabei unterstütze. Die Holländer hätten sowieso Soldaten auf den Beinen und hätten ebenso viel Interesse daran wie das Reich selbst, dass die Spanier sich nicht im Cleveschen festsetzten. Was? rief der Herzog von Braunschweig entrüstet, mit den Holländern wolle man gemeine Sache machen und ihnen gar noch Dank schuldig werden? Mit den Rebellen und Trotzköpfen, die es den Fürsten gleichtun wollten? Lieber wolle er spanisch oder türkisch werden, und es solle keiner mehr mit einem solchen Vorschlag seiner fürstlichen Ehre zu nahe treten. Dies war eine besondere Kränkung für Moritz von Hessen, der mit den holländischen Staaten in einem freundschaftlichen Verhältnis stand, so viel wie möglich Holländer nach Hessen zu ziehen und die dort herrschende Blüte an Kunst und Gewerbe in sein Land zu verpflanzen suchte.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Der Dreißigjährige Krieg»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Der Dreißigjährige Krieg» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Der Dreißigjährige Krieg» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.