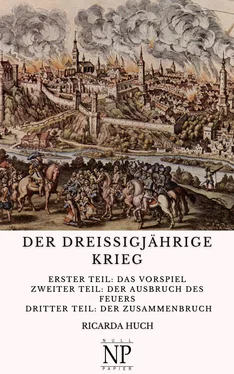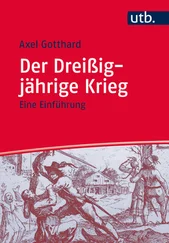Was Jan Wilhelm anbelangt, so bekam er krampfhafte Zufälle, wenn man nur den Namen seiner Frau nannte, und schimpfte sie Betrügerin, Zauberin und Hexe, die ihm zuerst mit gottlosen Ränken den Kopf krank gemacht und ihn dann für toll ausgegeben habe, um die Herrin zu spielen und seiner zu spotten. Als es ihr vermittelst ein paar treuer Diener gelang, ihm einen Brief zuzuspielen, in dem sie ihn an die eheliche Liebe und Treue mahnte und anflehte, sie im Unglück nicht zu verlassen, antwortete er ihr, er liebe sie zwar immer noch zärtlich, könne ihr aber wegen ihrer Untreue und Bosheit nicht mehr vertrauen und stelle alles der Zukunft anheim; und hernach noch einmal, er werde nun eine neue, hübsche und junge Gemahlin nehmen, bei der er es gut haben werde; mit ihr, Jakoben, habe er nichts mehr zu schaffen, und sie solle sich nicht unterstehen, wieder an ihn zu gelangen.
Trotz Schenkerns und Sibyllens Eifer schleppte der Prozess sich langsam hin; denn die kaiserlichen Abgeordneten waren beauftragt, nichts Endgültiges von sich zu geben, vielmehr die Sache hinzuspinnen, umso mehr, als Jakoben nichts nachzuweisen war, was ein Malefizurteil begründet hätte. Andererseits hätte ein Freispruch die Gegenpartei bloßgestellt und neue schwierige Knoten geschürzt. In allen Punkten vermochte sich Jakobe gut oder genugsam zu verteidigen. Sie gab zu, allerlei Mittel zur Heilung des Herzogs versucht zu haben, so habe sie Zettel mit Sprüchen in sein Wams eingenäht, um Zauber und schädlichen Einfluss von ihm fernzuhalten; aber die Gegenpartei, namentlich Sibylle, hätte dergleichen als etwas Übliches auch vorgenommen. Doktor Solenander gab das Urteil ab, solche Mittel seien zwar abergläubisch und könnten Krankheiten nicht überwinden, ebensowenig jedoch sie hervorrufen oder steigern. Dass sie Ehebruch begangen habe, bestritt sie, wenn sie auch zugestand, dass ein gewisser junger Edelmann ihr gern und häufig aufgewartet habe. Der freundliche Umgang mit ihm, sagte sie, könne ihr nicht als Sünde angerechnet werden, da sie so einsam und freundlos, einer Witwe gleich, gelebt habe. Am wenigsten ließ sich mit dem Verdacht der Ketzerei ausrichten, da sie die Anforderungen der protestantischen Stände niemals wirklich bewilligt hatte und viele Zeugen aussagten, wie fleißig sie nicht nur stets die Messe besucht, sondern auch die Andacht in ihrem Gemach verrichtet hatte. Als man ihr vorwarf, dass in dem fürstlichen Trauerhause, wo Gott, sei es zur Strafe oder zur Warnung, die Lichter ausgeblasen habe, sodass die Bewohner, voran Sibylle, in einem Labyrinth von Trübsal, Furcht und Grauen umhergeirrt wären, man sie allein, Jakoben, allezeit guter Dinge und zu Späßen aufgelegt gesehen habe, reckte sie sich ein wenig und sagte, man habe sie in ihrer Kindheit gelehrt, es sei fürstliche Pflicht und Tugend, den Kummer in sich zu verzehren und den Untertanen ein helles Antlitz zu zeigen, wie die Sonne von Gott bestellt sei, der Erde Licht und Wärme zu geben, deren sie bedürfe und von sich aus nicht mächtig sei.
An hilfsbereiten Freunden blieben Jakobe indessen doch nur zwei: der Kurfürst Ernst von Köln, ihr Oheim, 1und der Landgraf von Leuchtenberg, ihrer jüngeren Schwester Mann. Zwischen dem Kurfürsten und den Jülich-Cleveschen Räten, nämlich Schenkern und seinem Anhang, schwebte schon lange eine Streitsache, indem sie mehrere Ämter, die der Kurfürst als ihm zustehend in Anspruch nahm, dem protestantischen Grafen Bentheim verkauft hatten, was ihn darin bestärkte, sie für eigenmächtige, frevelhafte und nur den eigenen Nutzen bezweckende Leute zu halten. Sie ihrerseits sagten, man sehe wohl, warum er in Jakobens Angelegenheit ihr Widersacher sei; sie hätten ihn verhindert, sich auf Kosten von Jülich-Cleve zu bereichern, wobei ihm die Herzogin wohl gern behilflich gewesen wäre.
Dem Landgrafen von Leuchtenberg hätte in früherer Zeit Jakobe besser angestanden als ihre weniger schöne Schwester, und er hatte ihr eine gewisse Anhänglichkeit bewahrt, obwohl sie nun bald vierzig Jahre alt war und die Zauberei der Jugend nicht mehr ausstrahlte. Daneben war es ihm bange, die gewalttätigen und räuberischen Räte möchten sich des Juwelenschatzes der Jakobe bemächtigen, der nicht unbeträchtlich war und der, da sie keine Kinder hatte, nach seiner Meinung ihm zufallen musste, wenn sie etwa stürbe. In Anbetracht ihrer bedenklichen, unfreien Lage hätte er es angezeigt gefunden, dass sie ihm die Kostbarkeiten gleich jetzt in Verwahrung gäbe, und suchte eine Gelegenheit, die Übergabe heimlich zu bewerkstelligen. Der Landgraf konnte diesen Zuschuss gut gebrauchen, denn er watete bis zum Halse in Schulden und war oft nahe am Ertrinken. Indessen da er von Natur munter und umgänglich und dazu meistens betrunken war, erdrückte ihn die Sorge nicht, wenn er nur so viel auftrieb, um das Leben in seiner Art weiterzufristen. Sein gemütliches Wesen machte ihn geeignet, zwischen den streitenden Parteien im Reiche zu vermitteln, und so reiste er im Auftrage des Kaisers an den Höfen umher und erfüllte fröhlich seine Pflicht, indem er bei vollem Humpen den hadernden Fürsten gütlich zuredete.
Es war Mai, als der Landgraf mit seiner Frau in Düsseldorf ankam und zu seiner Schwägerin in das Schloss gelassen zu werden begehrte. Die Wachen jedoch gaben ihm zu verstehen, dass das nicht angehe, und trotz seiner Proteste musste er am Ende zufrieden sein, in einem Wirtshause vor der Stadt Quartier zu nehmen. Unter der Hand benachrichtigte er die gefangene Herzogin, dass er da sei und nachts in einem Boote vor ihr Fenster fahren und versuchen wolle, sich von dorther mit ihr zu besprechen. Jakobe, welche wenig Unterhaltung hatte, harrte willig vom Einbruch der Dunkelheit an im Fenster und vertrieb sich die Zeit mit bunten Erinnerungen aus ihrer schönen Jugend. Endlich weckte sie ein Glucksen und Rieseln des Wassers aus ihren Träumen, worauf sie bald die Umrisse eines näher gleitenden Nachens wahrnahm und das Zeichen eines wehenden Tüchleins, das ihre Schwester bewegte, ebenso erwiderte. Freudig erkannte sie den dicken Landgrafen und ihre zierliche Schwester, breitete die Arme aus, lächelte, dankte und erzählte flüsternd, sie sei wohlauf, es fehle ihr soweit an nichts, sie habe eine bescheidene Frau zur Bedienung, erhalte gut und reichlich zu essen, auch Wein zu trinken, freilich sei sie der Gefangenschaft müde, der Landgraf solle doch auf eine Zusammenkunft dringen; wenn sie seinen Ernst sähen, würden sie nicht wagen, ihm dauernd zuwider zu sein.
Читать дальше