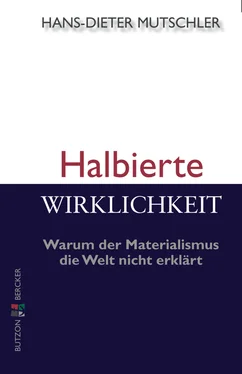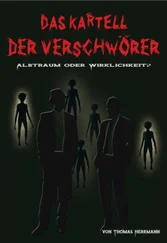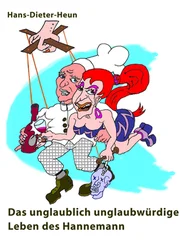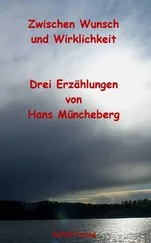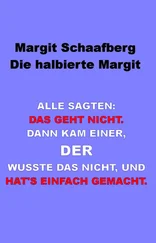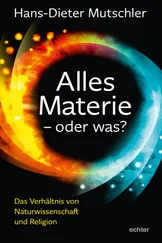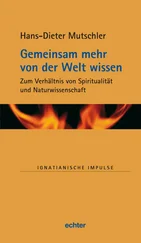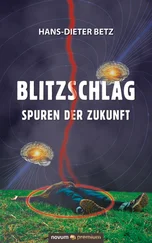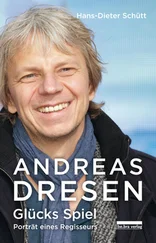Oft wird nicht zwischen einer gesicherten Theorie und ihrem Geltungsanspruch unterschieden. Aber beide sind logisch unabhängig voneinander. Wenn der Physiker eine „Great Unified Theory“ entwickelt, die in einem Formalismus alle vier Grundkräfte der Materie enthält, so kann er diese Theorie als eine „Theory of Everything“ interpretieren, mit dem Anspruch, alles zu erklären, was es auf der Welt gibt, vom Atom bis zur Trinität. In diesem Sinn hat sich z. B. der Physiker Steven Weinberg geäußert, der glaubte, er könne mit seiner Wissenschaft auch gleich noch die Biologie miterklären. Oder aber der entsprechende Physiker könnte auch den bescheideneren Anspruch mit seinen Formeln verbinden, lediglich die Kräfte der Materie zu berechnen, aber z. B. keine Aussagen über Lebendiges oder über den Menschen zu machen. So hat Werner Heisenberg seine Physik verstanden, obwohl er einer der Ersten war, der eine Weltformel an die Tafel schrieb. Die Formeln, die Heisenberg an die Tafel schreibt, könnten im Grenzfall genau dieselben sein, die Weinberg anschreibt, aber der damit verbundene Geltungsanspruch könnte dennoch radikal verschieden sein.
Diese Differenz betrifft alle Wissenschaften. Ich kann als Biologe den Anspruch stellen, die Eigenschaften aller Lebewesen unter Einschluss des Menschen erklärt zu haben. Oder ich kann gewisse Kulturleistungen, wie z. B. seine Moralität, davon ausnehmen. Die zugrundeliegende Biologie ändert sich dadurch nicht. Wenn also Konflikte zwischen Wissenschaft und Lebenswelt entstehen, dann ist man oft in der Lage, sie durch Überprüfung der Geltungsansprüche zu entschärfen. Ansonsten ist von einem Primat der Lebenswelt vor der Wissenschaft auszugehen. Die Menschheit hat lange ohne Wissenschaft im Sinn der Neuzeit gelebt, aber niemals ohne praktische Maximen oder ohne die Betroffenenperspektive. Und dann ist die Wissenschaft selbst von unseren praktischen Einstellungen substanziell abhängig. So schreibt uns z. B. die Natur nicht vor, welche Phänomene wir interessant oder forschungswürdig finden sollten. Wir legen die Richtung der Forschung fest, nicht die Objekte in Raum und Zeit! Theorie hängt entscheidend von Praxis ab, aber ohne in ihr aufzugehen. Diese etwas vertrackte Überblendung von Theorie und Praxis, die in diesem Buch eine wichtige Rolle spielen wird, steht allerdings bisher nicht im Focus des wissenschaftstheoretischen Interesses. Tatsächlich findet man dort so gut wie nichts zu dieser ganz entscheidenden Frage. Dies könnte ein gravierender Einwand gegen die hier vertretene Position sein: Wissenschaftstheorie in unserem Sinn gibt es seit rund 100 Jahren, also seit dem Wiener Kreis. Seither ist eine Menge Scharfsinn darauf verwendet worden, zu bestimmen, was eigentlich Wissenschaft sei z. B. im Unterschied zu Religion und Mythologie oder um zu verdeutlichen, welche logische Struktur wissenschaftliche Erklärungen haben sollten, auf welche Ontologie mich ein wissenschaftliches Modell verpflichtet usw. Es könnte vielleicht misstrauisch stimmen, dass in einer so mächtigen Tradition das hier verhandelte Problem praktisch ausfällt, aber der Sachverhalt klärt sich leicht.
Wissenschaftstheorie zerfällt nämlich, grob gesprochen, in zwei Arten, die genau dem Gegensatz zwischen Wissenschaft und Lebenswelt entsprechen. Die Mehrheit der Wissenschaftstheoretiker geht davon aus, dass Wissenschaft das wahre Wesen der Dinge erforscht. Der mainstream der Wissenschaftstheorie beschränkt sich eben nicht darauf, die logische Struktur wissenschaftlicher Erklärungen zu untersuchen, deren ontologische Verpflichtungen aufzuklären oder den Unterschied zwischen Wissenschaft und Religion herauszuarbeiten. Wissenschaftstheorie versteht sich seit dem Wiener Kreis vielmehr gerne als normativ in dem Sinn, dass sie darstellen kann, wie Rationalität auszusehen habe und zwar nicht nur die Rationalität der Physik, Chemie, oder Biologie, sondern Rationalität schlechthin. Die Intuition, die dahinter steckt, hängt mit der negativen Erfahrung zusammen, die man mit der spekulativen Philosophie namentlich des Deutschen Idealismus gemacht hatte. Es war besonders der Hegel’sche Idealismus, der den Eindruck hinterließ, man sei mit den empirischen Wissenschaften besser bedient als mit einer spekulativen Metaphysik. Dass es so einfach nicht ist, wird sich im Hegelkapitel des vorliegenden Buches zeigen. Aber zunächst einmal war dies die sehr verständliche Reaktion. Empirie statt Spekulation, Logik statt Dialektik, ein aufs Endliche gerichteter Verstand statt einer aufs Absolute gerichteten Vernunft, Analyse statt Synthese, kontrollierbares Experiment statt ausschweifender Phantasie usw.
Fasst man die Wissenschaftstheorie normativ in diesem Sinn, dann kann sie kein Interesse an pragmatischen Relativierungen haben, und in der Tat lässt sich beobachten, dass sich die Wissenschaftstheorie in ihrer Geschichte nach Kräften gegen die Pragmatik wehrte und sie nur ganz kontrolliert zuließ, und zwar dann, wenn ihr nichts anderes mehr übrig blieb. Man kann das z. B. sehr gut an der Entwicklung von Wolfgang Stegmüller verfolgen, der über Jahrzehnte der führende Wissenschaftstheoretiker in Deutschland war. Stegmüller hinterließ ein gigantisches Werk, in dessen zweiter Auflage er vorsichtige pragmatische Retuschen anbrachte, aber nie so, dass er sich ernstlich auf Praxis, also z. B. auf das experimentelle Handeln oder auch auf die Moral eingelassen hätte. Die Lebenswelt blieb außen vor; die Theorie genügte sich selbst.
In dieser Tradition hatte man also wenig Interesse daran anzuerkennen, dass ein volles Verständnis wissenschaftlicher Erkenntnisse nur möglich ist, wenn wir sie in die Lebenswelt zurückbinden, denn dies würde ja eine fundamentale pragmatische Relativierung bedeuten, woran bei solchen Autoren kein Interesse bestand. Es soll weiter unten im Kapitel über das Materie- und das Kausalprinzip gezeigt werden, was das praktisch bedeutet. Der Wissenschaftstheoretiker ist nämlich darauf festgelegt, auch das Materie- und Kausalprinzip allein aus der exakten Wissenschaft abzuleiten. Es wird sich aber zeigen, dass das ausgeschlossen ist. Was Materie und was Kausalität sind, wissen wir aus unserer praktischen Lebenswelt, nicht aus der Physik. Das bisher Gesagte betrifft allerdings nur den mainstream der Wissenschaftstheorie, die das Wort Theorie nicht umsonst im Namen trägt.
Anders ist es mit einer Minderheit von Wissenschaftstheoretikern, die sich wesentlich auf die Praxiskonstitution von Wissenschaft beziehen, die also die Wissenschaft an die Lebenswelt rückbinden. In Deutschland betrifft diese Minderheit vor allem die Erlanger Schule mit Autoren wie Paul Lorenzen, Friedrich Kambartel, Jürgen Mittelstrass oder Peter Janich. In dieser Schule wird der Akzent auf die Praxis gelegt und zwar auf beides, politisch-moralische und experimentell-technische Praxis. Insofern hat diese Schule ein großes Verdienst, denn die analytischen Wissenschaftstheoretiker haben gerne so getan, als finde Wissenschaft gleichsam im luftleeren Raum statt, so als wüchsen die Theorien auf den Bäumen. In der angelsächsischen Welt, die die wissenschaftstheoretische Diskussion dominiert, hat die Erlanger Schule Deutschlands kaum Spuren hinterlassen. Ein trauriges Beispiel für die auch sonst zu beobachtende Hegemonie der Angelsachsen. Wissenschaft folgt leider oft denselben Mustern wie der politisch-militärische Bereich. Wer die Macht hat, hat auch das Recht, so scheint es.
Peter Janich ist vielleicht der radikalste Konstruktivist der Erlanger Schule . Er geht aus von der „wahrheitsstiftenden Funktion des Handelns“ und fächert dies in Bezug auf technische Handlungsnormen hin auf, um im Sinn einer „Protophysik“ die Praxiskonstitution von Wissenschaft zu klären. Das ist zwar sehr viel, aber bei ihm ist es auch schon alles. Er anerkennt z. B. keine ontologischen Fragestellungen. So wendet er sich etwa dagegen, dass bei „den meisten Wissenschaftsphilosophen naturwissenschaftliche Theorien als Aussagensysteme mit Behauptungscharakter“ gelten. Die Rede über Naturgesetze gehört nach Janich zu einer „mythisierenden Überhöhungsliteratur“. Naturwissenschaften seien letztlich nichts anderes als technisches Know-how: „,Naturgesetze‘ sind demnach nur Aussagen über funktionierende Maschinen, ja sie können ohne Umformulierung auch als Konstruktionsanweisungen für Maschinen gelesen werden.“ 9
Читать дальше