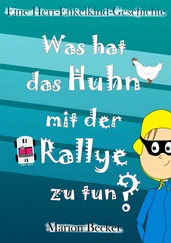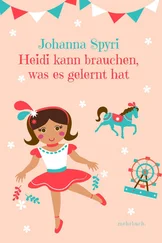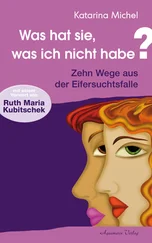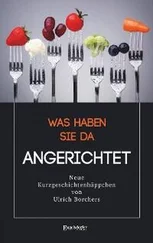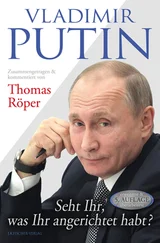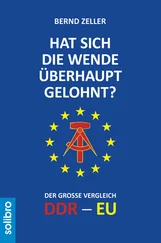Das Bündnis sollte keinesfalls gegen den Kaiser gerichtet sein, sondern „allein zur Erhaltung christlicher Wahrheit und des Friedens im Heiligen Reich und deutscher Nation“ bestehen. Voraussetzung war, dass in dieser Hinsicht ein legitimes Widerstandsrecht nicht bestand. Denn Luther hatte grundsätzlich gelehrt, dass ein Christenmensch die ungerechte Obrigkeit erleiden müsse. Aber dem Bedrohungsszenario der Schmalkaldener verschloss er sich nicht. In Nürnberg entstand das Argument, das Reich sei eine „Konföderation“, und jeder Reichsstand habe Rechte und Pflichten, zu seinen Rechten gehöre auch, kaiserliche Gebote zurückzuweisen, denn das Reich, wie aus seinem Status einer „Konföderation“ folgte, stehe nicht in der absoluten Verfügungsgewalt des Kaisers.
Das waren Positionen zur weiteren Vertiefung der Spaltung im Reich, die unvergessen blieben, auch wenn die Kriegsgefahr sich bald wieder verzog. Nach dem Tod Zwinglis riet Ferdinand seinem Bruder zum Zuschlagen, doch der wusste, dass die Schmalkaldener auf Frankreich hofften, und wollte keine schlafenden Hunde wecken. Dazu traten erneute osmanische Kriegsrüstungen; anscheinend hatte der Sultan seine Niederlage vor Wien nicht verwunden. So kam es Anfang 1532 auf dem Reichstag zu Regensburg und nach weiteren Diskussionen im Juli 1532 zum „Nürnberger Anstand“. Darin griff man der Sache nach auf die Respektierung des Status quo von Speyer 1526 zurück, der unter dem Vorbehalt eines einzuberufenden Konzils stand. Von dem aber wusste man, dass der Papst es nach wie vor perhorreszierte. Diese Ablehnung versteckte er, durchsichtig genug, indem er zur Vorbedingung dessen Zusammentreten in Italien machte und dass die Protestanten bis dahin den ursprünglichen kirchlichen Zustand wieder herstellten.
Die Alternative wäre gewesen, dass der Kaiser es seinerseits einberief und dazu den Schulterschluss mit den deutschen Fürsten suchte. Doch diesen Wagemut brachte er nicht auf. Er hätte mit dieser Initiative den Papst verprellt, und das, während die Osmanen angriffen und die Haltung von Frankreich unsicher war. Zudem wären die Protestanten ein sehr eigenwilliger Partner gewesen, wie sich wieder in Augsburg gezeigt hatte. Der Erfolg des „Nürnberger Anstandes“ war immerhin, dass die Protestanten Heeresfolge gegen den Sultan versprachen und dann auch leisteten. Dass dabei militärisch nichts herauskam, für den Sultan übrigens auch nicht, war einzig den Unwägbarkeiten zuzuschreiben, die kriegerischen Operationen in allen Zeiten nun einmal anhaften. Aber spätere Interpretatoren haben die Sache auf die Spitze getrieben, indem sie meinten, ohne den schrecklichen Druck der Osmanen wäre das Reich damals unter dem Konflikt von Alt- und Neugläubigen auseinandergebrochen.
Der Schmalkaldische Bund konnte nicht ohne Gegenwirkung der katholischen Fürsten bleiben, die politische Konfrontation war das Pendant der religiösen. Dabei nahm das Herzogtum Bayern eine zentrale Rolle ein. Die Bayern waren schon immer auf die Habsburger eifersüchtig gewesen, was dadurch nicht gemindert wurde, dass die Herzöge von München entschlossen auf der katholischen Seite standen. Herzog Wilhelm IV. hatte der Ausbreitung lutherischen Gedankenguts zwischen Lech, Donau und Hausruck nach Luthers Thesenanschlag zusehen müssen. An des Herzogs katholischer Ausrichtung bestand nicht der geringste Zweifel. Dass in der Kirche Missstände eingerissen waren, das versuchte er den Bischöfen seines Territoriums und auch dem Erzbischof von Salzburg einzuschärfen, wenn auch ohne Erfolg, da diese Prälaten zu Recht argwöhnten, er wolle durch eine gemeinsam durchzuführende Disziplinierung den weltlichen Rechtsbereich in den kirchlichen hinein ausweiten.
Als besonders gefährlich galten die Anhänger der Wiedertäufer, die die von Luther beibehaltene Kindertaufe verwarfen. Das herzogliche Motto lautete: „Es wird keiner ein Wiedertäufer, er sei denn zuvor lutherisch!“ Daran stimmte, dass Luthers Sturm auf die kirchlichen Autoritäten geistliche Bewegungen freigesetzt hatte, die man von Wittenberg aus unmöglich kontrollieren konnte. Dass Wittenberg am Bauernkrieg schuld war, galt auch bei Hofe in München als ausgemachte Sache. Ab 1527 wurde das Herzogtum von einer Verfolgungswelle gegen die Neugläubigen heimgesucht, die bis dahin beispiellos war.
Das Verhältnis zu Habsburg gestaltete sich eher nachteilig, da Ferdinand 1526 an dem wittelsbachischen Aspiranten vorbei die böhmische Königskrone gewonnen hatte und da der Herzog auch mit dem Bestreben nicht zum Zuge kam, anstelle Ferdinands zum Römischen König gekürt zu werden.
Der Ingolstädter Professor Johannes Eck war für den Reichstag von Augsburg maßgeblich an der Abfassung der „Confutatio“ beteiligt. Wenn der Kaiser am Rande des Reichstages versuchte, den Papst zur Einberufung eines Konzils zu bewegen, dann stand München insofern zu der ablehnenden Haltung Roms. München war auch nicht daran gelegen, dass der Kaiser in Augsburg einen Erfolg als überparteilicher Schlichter errang, denn das hätte ihn zum Herrn im Reich gemacht, und der besondere Kontakt Bayerns zu Rom wäre dann wertlos geworden. Die Interpreten haben sogar darüber nachgegrübelt, ob Bayern diesen Kontakt nicht überschätzt hat und stattdessen die Reformation im Herzogtum hätte einführen sollen, zumal die administrativen Kapazitäten dazu durchaus ausreichend waren.
Wilhelm IV. war in seiner Eifersucht auf die Habsburger so wenig von Vorurteilen gehemmt, dass er auch mit dem Schmalkaldischen Bund paktierte (Vertrag von Saalfeld, Herbst 1531). Da kam man überein, sich gemeinsam nach auswärtigen Partnern umzusehen, mit dem Ergebnis des bayerisch-französischen Paktes von Scheyern (1532), in dem Franz I. Unterstützung des schmalkaldischen militärischen Apparates versprach.
Dann wieder nützten die Schmalkaldener mit einer entschlossenen Initiative Philipps von Hessen die Chance, die ihnen die bayerische Annäherung bot, denn durch diese wurden die Aspirationen der Wittelsbacher auf Übernahme des von Habsburg 1519/20 übernommenen Herzogtums Württemberg neutralisiert. Und Philipp führte 1534 mit kriegerischer Hand den 1519 gestürzten Herzog Ulrich an den Neckar zurück. Ulrich bedankte sich, indem er anschließend seine obrigkeitlichen Kräfte zur Reformation im Herzogtum sehr erfolgreich einsetzte.
Wilhelm IV. blieb aber nichts anderes übrig, als sich nach Habsburg umzuorientieren. So kam es zum „Kaiserlichen Bund“ von 1535, an dem der Herzog, der Kaiser, König Ferdinand, der Erzbischof von Salzburg, die Bischöfe von Bamberg, Eichstätt und Augsburg, das Fürstentum Pfalz-Neuburg sowie Ansbach, das durch die Schmalkaldener nicht gebunden war, teilnahmen. Auch Protestanten durften also beitreten. Es war ein Versuch, doch es war auch kaum ein Schaden, als sich der „Kaiserliche Bund“ 1543/44 sang- und klanglos auflöste.
Anders stand es um den „Nürnberger Bund“ vom Juni 1538. In dem schlossen sich die weltlichen und geistlichen Herren des bayerischen Reichskreises zusammen, damit sie, wie sie sagten, vor den Schmalkaldenern geschützt seien, denn nur unter dieser Voraussetzung seien sie imstande, dem Kaiser gegen die Osmanen Hilfe zu leisten. Auch das albertinische Herzogtum Sachsen und das immer noch katholische Braunschweig-Wolfenbüttel waren dabei. Der Kaiser trat bei, hatte aber eher die Absicht, mit den Protestanten zu einer gütlichen Einigung zu kommen, wieder einmal, da ihn Frankreich und die Osmanen gleichzeitig, wenn auch nicht richtig koordiniert, bedrängten. Zudem wollte er sich von fürstlichen katholischen Eiferern nicht seine Politik im Reich diktieren lassen. Er dachte zwar beständig an den Krieg gegen die Protestanten, aber nur als eine ultima ratio .
Der Papst, nunmehr Paul III. (1534 – 1549, aus dem Hause Farnese), legte auch keinen Wert auf die anti-schmalkaldische Ausrichtung des Bundes, da er der kaiserlichen Ausgleichspolitik mit den Protestanten eine Chance geben wollte, um damit im nicht auszuschließenden Erfolgsfall die Idee eines allgemeinen Konzils überflüssig zu machen.
Читать дальше