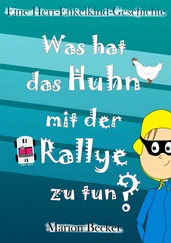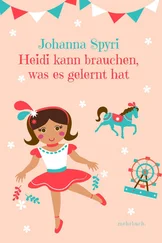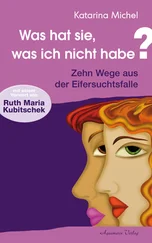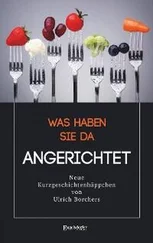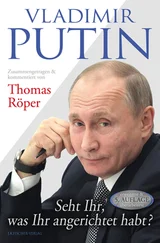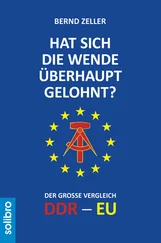1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 Die „Christliche Vereinigung“ in Oberschwaben gab sich eine Bundesordnung, eine Eidesformel und eine Predigt- und Landesverordnung – Staatsaufbau von unten anstatt, wie herkömmlich, von oben, und die geistlichen Fürsten hätten in diesem keinen Platz mehr haben dürfen. Sonstige Obrigkeiten wurden durchaus respektiert. Denn die Obrigkeit war nach dem Römerbrief des Paulus (13,1) durchaus hinzunehmen, sofern sie sich – dies die aktuelle Auffassung anno 1525 – zur göttlichen Gerechtigkeit gemäß der Heiligen Schrift bekannte. Tat sie das nicht, konnte eine Pflicht zum Widerstand gegen sie entstehen, gemäß dem üblichen biblischen Gegenzitat zu dem Römerbrief, das aus Apostelgeschichte 5,29 zu entnehmen war: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ Damit wurden die Pforten zu einer veritablen Revolution sichtbar. Der Kaiser sollte der Oberherr bleiben, aber im dergestalt fortbestehenden Heiligen Römischen Reich waren dem „gemeinen Mann“ feste konstitutionelle Rechte einzuräumen. Solche Überlegungen, die ebenso wenig wie die Memminger Zwölf Artikel zum allgemein verbindlichen Gut der gesamten Bewegung wurden, waren nicht schlechthin utopisch. Aber sie gingen unter im kurzen Krieg der miserabel ausgerüsteten Bauernhaufen gegen die professionellen Landsknechtstruppen der Status-quo-Mächte, der Fürsten, Bischöfe und der Reichsstädte. Zu Aberzehntausenden wurden die Bauern abgeschlachtet, im September 1525 war Schluss. In den Bistümern Würzburg und Bamberg nutzten die Sieger die Gelegenheit, um auch Anhänger Luthers hinzurichten, die mit dem Bauernaufstand nachweisbar nichts zu tun gehabt hatten. In Schwaben und Franken wurden vierzig evangelische Prediger aufgehängt.
Luther hatte die Zwölf Artikel abgelehnt, weil da soziale Forderungen, wie legitim auch immer an sich, als Glaubensartikel daherkamen. Das Gericht über frevelhafte Obrigkeiten sei Sache Gottes, nicht der Menschen. Darin war sich Luther mit der Mehrheit der evangelischen Theologen einig. Von altgläubiger und Status-quo-Seite wurde der Vorwurf erhoben, Luther und die Seinen hätten die Bauern aufgehetzt. Der große Humanist Erasmus von Rotterdam war subtiler, aber ebenso verdammend: Der Bauernkrieg sei die logische Folge von Luthers Bewegung. Erzherzog Ferdinand, des Kaisers Bruder und späterer Nachfolger, der dessen Geschäfte in Deutschland besorgte, sprach vom Bauernkrieg schlicht als von der „lutherischen Sache“.
Das veranlasste Luther zur Selbstverteidigung in der Form des Angriffs, zu seiner scharfen Schrift vom Mai 1525: „Auch Widder die reubrischen und mördischen rotten der andern bawren.“ Er ließ seinem starken polemischen Temperament die Zügel schießen: „Steche, schlage, würge hier, wer kann!“ Hinter solcher Ausfälligkeit stand jedoch seine Absicht der geistigen Erneuerung der Religion, die durch politische Radikalisierung nur verlieren konnte.
Sein klassischer Gegenspieler in dieser Auffassung war der Prediger Thomas Müntzer aus Stolberg im Harz, weshalb beide sich in gegenseitigen Schmähreden nichts schuldig blieben. Müntzer ging vom nahenden Ende der Welt aus. Das tat auch Luther, nach Paulus, 1. Thessalonicherbrief 5,2 – 3: „Denn ihr selbst wisset gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht.“ Aber er reagierte auf diese Ungewissheit mit Ergebung: „Wenn ich wüsste, dass morgen der Jüngste Tag wäre, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“, soll er gesagt haben. Er hat ja auch im Juni 1525 geheiratet, als die Massakrierung der Bauern, deren Krieg man nach damaliger Mentalität als Vorboten des Jüngsten Gerichts auffassen konnte, immer noch andauerte, und damit ein Zeichen gesetzt, auch in apokalyptisch sozusagen verdächtiger Zeit menschliche Demut angesichts des Unerforschlichen zu üben.
Thomas Müntzer lebte jedoch in dem Glauben, die Menschheit auf das kurz bevorstehende Jüngste Gericht besonders vorbereiten zu müssen. Der Antichrist herrschte, die im Pfuhl der Sünde versunkene Obrigkeit, so Müntzer. Die Herrschaft des Antichristen war nach mittelalterlichen Vorstellungen, die Müntzer teilte, der Vorbote des Jüngsten Tages. Also mussten die Auserwählten Gottes sich vereinigen, um dem Weltenrichter geordnet gegenüberzutreten. Der nur äußerliche Kult der Altgläubigen war dazu ebenso untauglich wie die lutherische Bewegung, denn die klammerte sich an die Worthülsen von Bibel und Predigt.
Wenn die Obrigkeit, was sie Müntzer gegenüber in der Gestalt des Herzogs Georg von Sachsen ablehnte, am Ziele der Sammlung der Auserwählten, der die Ausrottung der Gottlosen parallel zu laufen hatte, nicht mitwirken wollte, war sie ihrerseits auszurotten. Für Müntzer waren die Thüringer Bauernhaufen die berufenen Werkzeuge Gottes, um die uneinsichtige Obrigkeit rechtzeitig vor dem Weltenende über die Klinge springen zu lassen. Eine schärfere weltliche Instrumentalisierung von Religion zur Gewinnung des apokalyptisch verstandenen Heils lässt sich nicht denken. Müntzer hetzte die militärisch unbedarften Bauern geradezu in den Tod gegen das Heer der Fürsten (Schlacht von Frankenhausen, 15. Mai 1525), weil er in seinem spiritualistisch hochgepeitschten Predigen die Beziehung zur Realität verloren hatte. Das war ein schlimmeres Vergehen als Luthers Invektive gegen die aufrührerischen Bauern.
Das Schauerdrama des Bauernkriegs gibt Anlass, Luthers Verhältnis zur Obrigkeit vor dem Hintergrund seiner religiösen Überzeugungen, aber auch des Bedürfnisses, seiner Bewegung einen dauerhaften Halt zu geben, eingehender zu erörtern. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Es blieb ihm, politisch gesehen, nichts anderes übrig, als sich auf die reale Fürstenmacht im Reich zu stützen, nachdem ausschließlich der sächsische Kurfürst ihn vor dem Ketzertod bewahrt hatte. Um die Territorialfürsten kam in Deutschland noch bis 1918 niemand herum. Den Kaiser konnte Luther nicht als Schutzherrn nehmen, denn der musste in seiner Altgläubigkeit verharren.
Die Problematik dabei ist, dass Luther wegen seiner Haltung als „Fürstenknecht“ abgestempelt wurde, als ein bleierner Konservativer, wenn nicht gar Reaktionär – als ob er um 1525 schon an die Französische Revolution und an die moderne Demokratie hätte denken können! Hätte Luther sich verschwärmt wie Thomas Müntzer oder andere Anarchoide aus seiner Gefolgschaft, die er im März 1522 in Wittenberg dämpfen musste, z. B. seinen Anhänger Andreas Karlstadt, dann wäre seine Bewegung eine Episode geblieben wie einst diejenige der aggressiven Hussiten.
1523 brachte Luther die Schrift „Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei“ heraus. Die Fürsten kommen, unter dem Zeichen der Gerechtigkeit betrachtet, dabei denkbar schlecht weg. Dann entwickelt der Autor das, was seine Zwei-Reiche-Lehre genannt wird und was aus der „Freiheit eines Christenmenschen“ heraus entwickelt ist, sowie aus des heiligen Augustinus, des Ordenspatrons Luthers, Schema von civitas terrena , civitas Dei und der Schnittmenge beider auf Erden, der civitas permixta . Die wahrhaft Gläubigen gehören zum Reich Gottes, die des weltlichen „Schwertes“ als einer disziplinierenden Zwangsgewalt nicht bedürfen, weil sie ohnehin das Gute tun. Das Reich Gottes besteht aber auf Erden nicht, sondern es besteht aus Menschen, die zum Bösen geneigt sind, die daher „unter das Schwert geworfen“ sind. Das Reich Gottes und das der Welt sind einander zugeordnet, wobei die Welt nicht nach dem Evangelium regiert werden kann, dieses aber den Auftrag des weltlichen Reiches (oder Regiments) bestimmt und auch begrenzt. Indem das weltliche Regiment für Ruhe und Ordnung sorgt, schafft es auch die Bedingungen zur Verkündigung des Evangeliums. Das gemahnt an den alten Gedanken, Gott habe die Bildung des weltumspannenden Römischen Reiches gefördert, damit in diesem Einheitsraum die christliche Botschaft für alle Erdenbewohner desto besser Fuß fassen konnte.
Читать дальше