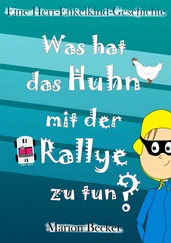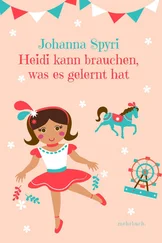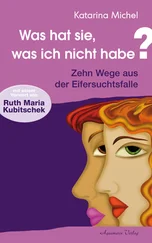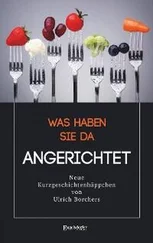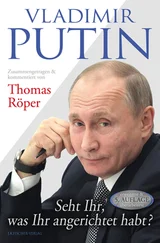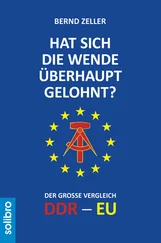Die Reichsstadt Nürnberg, mit Ulm, Augsburg und Straßburg die bedeutendste in deutschen Landen, war nach einer Diskussion zwischen Alt- und Neugläubigen im Rathaussaal am 3. März 1525 endgültig zum Luthertum abgeschwenkt und lud Melanchthon ein, eine höhere Schule nach seinen Vorstellungen zu errichten. So entstand 1526 das, offiziell aber erst seit 1933 so genannte, „Melanchthon-Gymnasium“ als erstes – später so bezeichnetes – „Humanistisches Gymnasium“ in Deutschland. Auch anderswo wurden Lateinschulen und höhere Lehranstalten gegründet, so 1539 das „Gymnasium illustre“ in Straßburg. Der Pommer Johannes Bugenhagen machte sich um Einführung und erste Reglementierung der Reformation fast in ganz Norddeutschland verdient; auf ihn gingen die Gymnasien in Hamburg (1529), Lübeck (1531) und Schleswig (1542) zurück.
Der Nürnberger Rat hatte sich der Reformation nicht nur aus Sympathie angeschlossen, sondern auch, weil er sie als eine Bewegung in der Bürgerschaft wahrnahm, die an ihn ganz neuartige Forderungen stellte. Die Gefahr der ernsthaften Beeinträchtigung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung, auf denen die Leistungsfähigkeit des städtischen Wirtschaftssubjektes aufbaute, war mit dem Vordringen der neuen Lehre verbunden, wenn es tumultuarische Züge annahm. Also schien es dem Rat besser, sich an die Spitze der Bewegung zu stellen. Da war die „Reformation von oben“ die Reaktion auf und der Abschluss der „Reformation von unten“.
Überhaupt waren die Städte besondere Pflanzstätten der Reformation, denn dort konnten mehr Leute Luthers Flugschriften lesen, und Gruppen, etwa die Handwerker, nahmen die neue Lehre zum Ausgangspunkt, um ihre Mitwirkung an politischen Entscheidungen durchzusetzen, von denen sie bis dahin ausgeschlossen gewesen waren. Die propagierten höheren Lehranstalten im neuen Geiste hatten in den Städten ein zahlreicheres Publikum als auf dem Lande. Die Autorität des Stadtregiments wuchs insgesamt. Denn nun waren die Geistlichen kein eigener Stand mehr, sondern Bürger wie die Laien; mit der Auflösung der Klöster verschwand deren bis dahin abgeschotteter Rechtsraum, und bischöfliche Eingriffe in städtische Verwaltung und Gerichtsbarkeit, ein Streitthema schon seit langer Zeit, wurden unterbunden.
Nur 14 der 78 Reichsstädte (Stand im 16. Jahrhundert) blieben dem alten Glauben treu, wobei religiöse und pragmatische Gründe kaum zu trennen waren. So gingen die Stadtväter von Überlingen rigoros gegen Anhänger Luthers vor, sobald sich diese zu regen begannen, und blieben katholisch, weil sie ihren Handel mit den und durch die sie umgebenden habsburgischen Gebiete nicht gefährden wollten. Die Kölner Reichsstädter brauchten den Austausch mit den Niederlanden, deshalb hielten auch sie sich zurück. Im Sommer 1529 wurden die Reformierten aus der Reichsstadt Rottweil vertrieben, weil der Kaiser gedroht hatte, sein Landgericht dort abzuziehen, das als Relikt aus den Zeiten übrig geblieben war, als die Kaiser noch Herzöge von Schwaben waren und dort dem Reiche Güter gehörten.
An dieser Stelle ist der Toggenburger, also Schweizer, Ulrich Zwingli zu erwähnen, dessen Einfluss nicht nur südlich des Bodensees, sondern auch nördlich davon im Sinne der Reformation wirkte. Zwingli achtete Erasmus von Rotterdam († 1536) sehr hoch, der durch seine vorbildliche griechische Ausgabe des Neuen Testaments (1516) der Bibelübersetzung Luthers vorgearbeitet hatte. Erasmus hielt die friedliche „Bergpredigt“ (Matthäus, Kap. 5–7) für den Angelpunkt des Christentums und war in seiner humanistischen Geneigtheit dafür, auch diversen berühmten Heiden der klassischen Antike mustergültige Tugendhaftigkeit zuzuerkennen, als ob sie Christen gewesen wären. Zwingli versetzte sie deshalb auch ins Paradies, aber die Untauglichkeit der Bergpredigt für das Regieren in dieser Welt war ihm klar. Nachdem er 1518 vom Rat der Stadt zum „Leutpriester“ am Großmünster in Zürich berufen worden war, betonte er die alleinige Verbindlichkeit der Heiligen Schrift, indem er ab Januar 1519 seine Predigten zu einer Reihe von Interpretationen der Bücher des Neuen Testamentes machte. Darin war er Luthers Lehre verwandt, und auch darin, dass er die Erlösung nicht von „guten Werken“ konditionieren ließ, sondern sie einzig der Gnade Gottes anheimstellte.
Großen Eindruck machte auf ihn Luthers Rede auf der Leipziger Disputation (Juli 1519), dass auch ein Konzil irren könne. Mit der amtlichen Hierarchie brach er. Die Existenz des Fegefeuers lehnte er ab, denn wenn der Sünder sein Heil durch den Glauben erlange, dann würden damit besondere Strafen, auch temporäre, im Jenseits überflüssig. Luther distanzierte sich von der Idee des Fegefeuers erst, nachdem Zwingli 1531 umgekommen war.
Zwingli lehnte auch den Zölibat ab und verheiratete sich. Heiligenverehrung, Prozessionen und Wallfahrten (Letztere als „gute Werke“) waren sinnlos. Mit seinem Bilderverbot, das der Rat der Stadt Zürich 1524 durchsetzte, stand er jedoch in Gegensatz zu Luther: Der war verbunden mit Lucas Cranach dem Älteren, dem langjährigen Hofmaler des Kurfürsten. Cranach hat, neben altgläubigen, mythologischen und allegorischen Sujets, auch das reformationsbewegte Altarbild in der Stadtkirche von Wittenberg geschaffen.
Zwingli unterschied sich weiterhin in zwei wesentlichen Punkten von Luther. Er arbeitete mit den Mitteln obrigkeitlicher Politik dafür, aus seinem Zürich eine vorbildliche christliche Gemeinde zu machen, nur als Ratgeber mitwirkend, aber damit von unvergleichlicher Autorität. Der Kurfürst von Sachsen als maßgeblicher Schutzherr Luthers hätte dies in solcher Direktheit nimmermehr zugelassen. Da auch Zwingli die sakramentale Qualität der Ehe ablehnte, wodurch Scheidungen möglich wurden, installierte der Rat ein besonderes Ehegericht, das bald zu einem allgemeinen Sittengericht wurde – eine Vorahnung zu der juristisch ausgefeilten und theokratisch gemeinten Stadtrepublik von Genf, die der von Luther erweckte Jean Calvin ab 1541 ins Leben rief.
Luther hatte seine Geistkirche und baute im Rahmen seiner Lehre von den zwei Reichen auf die weltliche Institution, die in seinem Kurfürsten verkörpert war, um die Erbsünde der Untertanen in Schranken zu halten. Zwingli forderte eine Identität von Staat und Kirche: „Eine christliche Stadt ist nichts anderes als eine christliche Kirche, ein Christenmensch nichts anderes als ein treuer und guter Bürger.“
Der zweite Punkt des Unterschiedes bestand in der Auffassung über den Charakter des Abendmahles (katholisch Eucharistie bzw. Kommunion). Matthäus 26,26 – 28 lautet: „Nehmet, esset! Das ist mein Leib […] Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.“ Luther folgerte daraus die reale Gegenwart von Leib und Blut Christi im Abendmahl. Zwingli hingegen argumentierte aus Johannes 6,63: „Der Gott ist’s, der da lebendig macht, das Fleisch ist nichts nütze.“ Das Abendmahl war also nur eine symbolische Feier, wodurch das Mysterium verschwand, an dem Luther und auch die Katholiken festhielten. Der sich hier zeigende Rationalismus war Luther ein Gräuel.
Im Oktober 1529 vermittelte Landgraf Philipp von Hessen ein Gespräch der beiden reformatorischen Kontrahenten in Marburg, doch der Dissens blieb, worüber sich die Altgläubigen diebisch freuten. Da zeigte sich einmal mehr, dass Luther in seinem Glaubensfuror aus dem Erfolg der deutschen Reformation einerseits nicht wegzudenken war, andererseits aber keinen entwickelten Sinn für politische Kombinationen hatte. Denn der hessische Landgraf Philipp hatte das Treffen von Marburg angeregt als Voraussetzung für ein umfassendes Bündnis von Hessen, dem Kurfürstentum Sachsen, der reformierten „Orte“ der Eidgenossenschaft (neben Zürich auch Basel, Schaffhausen, St. Gallen, Appenzell etc.) und der süddeutschen Städte, die zu Zwingli neigten, z. B. Konstanz. Der Landgraf dachte auch an die Mitwirkung Frankreichs und der Republik Venedig, die sich aber heraushielten. Immerhin war das eine der ersten konfessionell geprägten Bündnisideen, wie sie der abendländischen Christenheit in den nächsten Generationen noch viel zu schaffen machen sollten und der Arbeit am friedlichen Ausgleich der Glaubensinteressen das Grab schaufelten.
Читать дальше