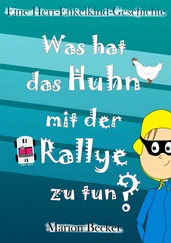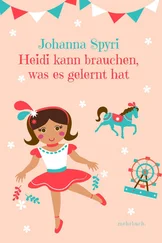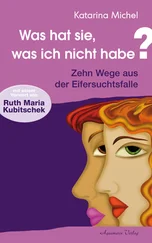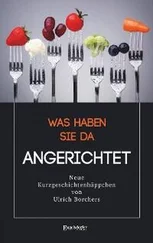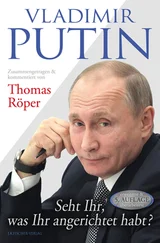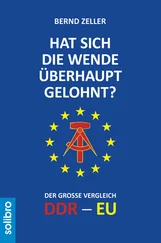Das Vergnügen der protestantischen Landsknechte an derlei Vandalismus war die eine Sache; die wichtigere andere Sache war, dass der Kaiser den Papst nun politisch entmachtet hatte und deshalb versuchen konnte, die Glaubens-Abtrünnigen in Deutschland aus eigener Initiative zum altgläubigen Gehorsam zurückzuzwingen, also die kirchlichen Zustände, die Frage von Reform und eventuellem Konzil, seinem eigenen Willen zu unterwerfen und damit seinen Vorgänger Sigmund und dessen Konzil von Konstanz zu übertrumpfen.
Auf dem Reichstag hatten die altgläubigen Fürsten eine Mehrheit, und natürlich wurden sie unterstützt von den geistlichen Fürsten. Die Konzession von Speyer 1526 sollte widerrufen werden, die Sympathisanten Zwinglis unter den Reichsständen (den Reichsstädten) waren sowieso ausgeschlossen. Dagegen protestierten, und von da leitet sich seitdem das Etikett „Protestanten“ her, Hessen, Kursachsen, Lüneburg, Anhalt und Ansbach. Zu ihnen standen viele Reichsstädte, auch altgläubig gebliebene, weil Speyer 1526 die konfessionelle Ruhe in Deutschland garantiert habe: Straßburg, Nürnberg, Ulm, Konstanz, Lindau, Memmingen, Kempten, Nördlingen, Heilbronn, Isny, Reutlingen, St. Gallen, Weißenburg, Windsheim. Darunter waren auch zwinglianisch geneigte.
Die Protestierenden appellierten an den Kaiser, der vor lauter großer Politik immer noch nicht anwesend war, und an die „nächste gemeine freie Versammlung der heiligen Christenheit“. Eine Minderheit verwarf in Sachen der Religion die Verbindlichkeit des Mehrheitsbeschlusses auf Ablehnung von Toleranz im Sinne von Speyer 1526 und auf Reaktivierung der Wormser Reichsacht. Damit erlitt auch die Autorität des Reichstages als einer Institution einen ernsthaften ersten Schlag, wie es bis zu der Konfrontation des Dreißigjährigen Krieges noch mehrere geben sollte, bis hin zur endgültigen Funktionsunfähigkeit des Reichstages in Regensburg 1613. Die Hoffnung auf die Wiederherstellung religiöser Einheit war deshalb immer noch nicht untergegangen, aber die Entwicklung brachte eine weitere Verfestigung des Dissenses. Das zeigte sich erneut auf dem Reichstag zu Augsburg 1530.
Karl hatte im Friedensschluss mit dem Papst (Barcelona 1529) versprochen, die Neugläubigen auf friedlichem Wege wieder zurückzubringen, und falls das nicht gelänge, seine Macht spielen zu lassen, „um die Schmach, die man Christo angetan, zu rächen“. Vor dem spanischen Staatsrat hatte er 1528 verkündet, das ketzerische Element müsse beseitigt werden, „so dass Historiker, die berichten, dass es während unserer Regierung begonnen hat, auch werden feststellen können, dass es mit meiner Hilfe und meiner Anstrengung zufolge ein Ende gefunden hat“.
Inzwischen war der Friede mit Frankreich siegreich geschlossen worden, Karl hatte sich nach Italien begeben, das er nunmehr so eindeutig dominierte, dass er dem Medici-Papst Clemens VII. den Wunsch erfüllen konnte, seine Familie wieder zur Herrschaft in Florenz zu bringen. Am 24. Februar 1530, dem fünften Jahrestag seines Sieges bei Pavia, ließ er sich vom Papst krönen, als letzter überhaupt in der Reihe der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Die Krönung fand in Bologna statt, kein deutscher Fürst war anwesend.
An diese ergingen unterdessen Einladungsschreiben zu einem Reichstag in Augsburg, die vom Willen zum friedlichen Ausgleich in Glaubenssachen kündeten. Karl wollte dazu helfen, „alle Meinungen zu einer einigen christlichen Wahrheit zu vergleichen und alles, so zu beiden Teilen nicht recht ausgelegt oder behandelt ist, abzutun“. Sofern der Kaiser sich insgeheim vorbehielt, die Protestanten mit Krieg zu überziehen, war das im Augenblick trotz der Grundlage, die er durch seine anderweitigen Siege gewonnen hatte, nicht opportun. Denn im Herbst 1529 war Sultan Süleyman erneut herangezogen, und diesmal war er bis zur Belagerung von Wien fortgeschritten. Auch wenn ihm diese misslang (am 14. Oktober zog er ab), war doch von nun an die habsburgische Ostflanke beständig schwer bedroht. Daher freundliches kaiserliches Gebaren gegenüber den Protestanten. Und da Karl das Reichsregiment nicht länger schätzte, musste er die Kurfürsten dazu bringen, seinen Bruder Ferdinand als Stellvertreter im Reich zu akzeptieren, was dessen Wahl zum „Römischen König“ bedingte, zum zukünftigen Nachfolger des Kaisers selbst.
Aber das Verfahren auf dem Reichstag war eher auf kaiserlichen Druck angelegt, unterstützt von der immer noch altgläubigen Mehrheit der Fürsten, als auf die versprochene friedliche Vergleichung. Am 25. Juni 1530 legten Sachsen, Ansbach, Lüneburg, Hessen, Anhalt, Nürnberg und Reutlingen die von Melanchthon systematisierte und redigierte Zusammenfassung der evangelischen Lehre in 28 Artikeln vor, die berühmte „Confessio Augustana“. Da die Protestanten mit den Zwinglianern uneins waren und das Gefecht von Kappel noch nicht stattgefunden hatte, fühlten sie sich eher zur Verteidigung als zum Angriff berechtigt. Es war daher bemerkenswert, was die „Confessio“ gerade nicht enthielt: keine Bestreitung des päpstlichen Primates, keine Reduzierung der Zahl der Sakramente, demnach auch keine Leugnung des character indelebilis , der lebenslang währenden Wirkung der Sakramente von Taufe, Firmung und Priesterweihe. Die weltliche Gewalt der geistlichen Fürsten wurde nicht in Zweifel gezogen. Andere Punkte mussten kontrovers bleiben, wie das Abendmahl unter beiderlei Gestalt und die Aufhebung des Zölibats, wofür man sogar ein zustimmendes Zitat bei Papst Pius II. (1458 – 1464) fand. Die zwinglianisch gesonnenen Reichsstädte Straßburg, Konstanz, Memmingen und Lindau legten ihre eigene „Confessio Tetrapolitana“ (Bekenntnis der vier Städte) vor.
Am 3. August wurde die katholische (den Ausdruck wollen wir von nun an verwenden) Antwort verlesen, genannt „Confutatio“ (Widerlegung). Die verharrte, außer bei einer Modifikation in der Lehre von der Rechtfertigung durch „gute Werke“, auf dem bisherigen kirchlichen Standpunkt: Die Ausgestaltung der Kirche auf Erden sei, einige Missbräuche hin und her, göttlichen Ursprungs.
Die katholische Mehrheit hielt die „Confutatio“ für ausreichend, um die Protestanten zur Rückkehr in den Schoß der Kirche aufzufordern. Das war das Gegenteil von gütlicher Diskussion; die Protestanten wurden nicht anders behandelt als einst Luther vor Kardinal Cajetan und auf dem Reichstag zu Worms. Allerdings blieben sie auch so fest bei ihren Überzeugungen wie Luther damals.
Melanchthon verfasste eine Antwort auf die „Confutatio“, deren Annahme der Kaiser ablehnte. Er war als überparteilicher Schlichter, falls er denn diese Rolle tatsächlich hätte annehmen wollen, gescheitert und ins Schlepptau der Katholiken geraten. Er mag die religiöse Wucht der Angelegenheit nicht genügend ernst genommen, den Glaubenskonflikt zu sehr von der politisch-formalen Seite her betrachtet und seine Autorität überschätzt haben. Am 14. November reisten die Vertreter des Landgrafen von Hessen und des Kurfürsten von Sachsen ab. Anschließend bestätigten die Verbliebenen der katholischen Mehrheit die Fortdauer der Wormser Reichsacht, verboten jegliche religiöse Neuerung und forderten die Rückgabe des bisher enteigneten Kirchenbesitzes. Zuwiderhandlung sollte als Bruch des Landfriedens gelten. Die Protestanten bekamen eine Frist bis zum 15. April 1531, sich diesen Beschlüssen zu beugen. Sie konnten zum damaligen Zeitpunkt nicht wissen, ob der Kaiser im Verweigerungsfalle nicht zum Krieg gegen sie entschlossen war.
Wegen des vermeintlich drohenden Angriffs des Kaisers trafen sich im Dezember 1530 zu Schmalkalden der Landgraf von Hessen, der Kurfürst von Sachsen, der Herzog von Braunschweig-Lüneburg, der Herzog von Braunschweig-Grubenhagen, der Fürst von Anhalt-Köthen, die Grafen von Mansfeld. Auch die Städte Magdeburg und Bremen waren vertreten. Im Februar 1531 war eine Bundesakte fertig, die auch die „Confessio Augustana“ beinhaltete. Es kamen noch hinzu: Straßburg, Lübeck, Konstanz, Ulm, Reutlingen, Memmingen, Lindau, Biberach, Isny, Braunschweig, Goslar, Einbeck, Göttingen, Esslingen, Augsburg, Frankfurt am Main, Kempten, Hamburg, Hannover und weitere Fürsten. Nürnberg und der Markgraf von Ansbach hielten sich heraus. Unterstützung durch die Könige von England, Frankreich, Navarra, Polen, Dänemark und Schweden wurde anvisiert.
Читать дальше