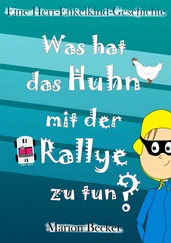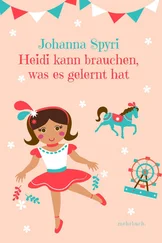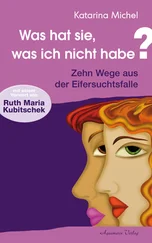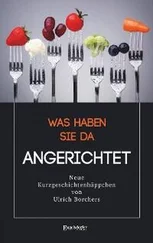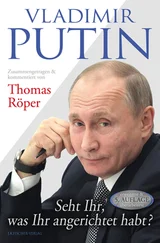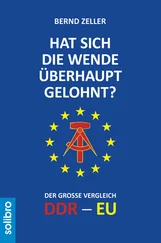Da Zwingli den gerechten Krieg befürwortete, stand er auch für dessen Führung zugunsten der Durchsetzung seiner wahren Lehre gegen die altgläubigen Kantone Luzern, Zug, Uri, Schwyz und Unterwalden, um deren Angriff zuvorzukommen, nachdem diese mit König Ferdinand, dem Bruder Kaiser Karls V., eine „christliche Vereinigung“ geschlossen hatten. Die Leute vom Vierwaldstätter See waren keine dumpfen Reaktionäre, aber sie bestanden darauf, dass die unbestreitbaren Defekte der Kirche Angelegenheiten des Papstes oder eines Konzils seien. Zwingli als urbaner Zürcher wies darauf hin, dass die „Waldstätte“, die Gründungskantone von 1291, auf der Ebene der gesamt-eidgenössischen Politik einen viel zu großen Einfluss hätten. So kam es im Herbst 1531 zum Krieg, zu dem Zwingli als Vertreter der Einheit von religiösem und staatsbürgerlichem Engagement selbst einrückte, und dabei im Gefecht von Kappel (an der Grenze zwischen den „Orten“ Zürich und Zug, 11. Oktober 1531) den Tod fand.
Das war nicht das Ende seiner Reformation in Zürich, denn die Sieger verstanden sich dazu, im Friedensschluss jedem Ort seinen eigenen Glauben zu konzedieren. Zudem war Zwinglis Gedankengut schon fest eingewurzelt. Die Situation erwies sich insofern als ähnlich der nach dem Sieg Karls V. im „Schmalkaldischen Krieg“ (1546/47) gegen die deutschen Protestanten.
Die Eidgenossenschaft hätte an ihren religiösen Gegensätzen zerbrechen können; das war fürs Erste abgewendet. Aber die reformationsgeneigten oberdeutschen Städte, deren Affinität zu den für Freiheit gegenüber fürstlicher Unterdrückung stehenden Schweizern Tradition hatte und die bis 1531 zwischen Luthertum und Zwinglianismus geschwankt hatten, zumal außer der Abendmahlslehre die religiös und innenpolitisch möglichen Punkte der Kontroverse noch nicht definitiv abgegrenzt waren, zogen es nun doch vor, nach Wittenberg anstatt nach Zürich zu schauen.
Des Kaisers große Politik
An dieser Stelle ist etwas an großer und an Reichspolitik nachzuholen, denn der geistlich-geistig-kulturelle Erfolg der Reformation war ohne diese weltlichen Gegebenheiten nicht möglich, siehe wenige Jahre vorher den Schutz des Kurfürsten Friedrich für den Ketzermönch.
Kaiser Karl V. hatte die Franzosen im Februar 1525 bei Pavia besiegen lassen und dabei sogar König Franz I. gefangen genommen. Er nötigte ihm einen demütigenden Friedensvertrag ab, den dieser sofort als abgepresst aufkündigte, sobald er wieder in Freiheit war, und mit Venedig, der Republik Florenz und dem Papst, dem das kaiserliche Übergewicht in Italien nun erst recht lästig war, schnell ein Bündnis zur Wiederaufnahme des Krieges schloss (Liga von Cognac, Mai 1526).
Hatte der Kaiser 1521 Luther in die Reichsacht getan, um den damaligen Papst zum Verbündeten zu gewinnen, so war er nun dieser Rücksichtnahme frei. In solcher Situation war auch der 1526 zu Speyer abgehaltene Reichstag nicht dazu angetan, die Vollstreckung der Reichsacht voranzubringen. Gerade, dass der Kaiser sie nicht aufhob, da er die katholischen Reichsfürsten nicht verprellen wollte. Er brauchte auch diejenigen, die zur neuen Lehre hinneigten neben Philipp von Hessen und dem neuen Kurfürsten Johann von Sachsen den Neffen des alten Kurfürsten, Herzog Ernst von Lüneburg, und den Hochmeister des Deutschen Ordens, Albrecht von Hohenzollern, der der starken reformatorischen Bewegung in Ostpreußen (damals minus Ermland) nachgegeben und sich auf Luthers eigens erbetenen Rat hin zum weltlichen Herzog erklärt hatte, in dieser Eigenschaft als Lehensmann des Königs von Polen. Karl brauchte die Reichsfürsten auch, da der osmanische Sultan Süleyman „der Prächtige“ gerade seine Heeresmassen gegen das Königreich Ungarn heranwälzte und des Kaisers Bruder Ferdinand, der Österreich verwaltete, Unterstützung anforderte.
Die Reichstage von Speyer 1526 und 1529
So kam es zu Karls Konzession in Speyer, dass der Reichstagsabschied (Karl selbst weilte in Spanien) jedem Stand bezüglich des Wormser Edikts bis zu der weiterhin erhofften, allgemeinen oder nationalen Kirchenversammlung erlaubte, „so zu leben, zu regieren und es zu halten, wie er es gegen Gott und Kaiserliche Majestät zu verantworten sich getraue“.
Damit hatten die der neuen Lehre zuneigenden Landesherren einen Freibrief erhalten, bei sich neugläubige Landeskirchen einzurichten. Wie provisorisch die bleiben würden, hing von der Realisierungsmöglichkeit der angesprochenen Kirchenversammlung ab, die man sich ohne Teilnahme der Neugläubigen noch nicht vorstellen wollte.
Karls Nachgiebigkeit zahlte sich aus, da die Fürsten militärische Hilfe für Ungarn versprachen. Doch zwei Tage darauf, am 29. August 1526, verlor der ungarische König bei Mohacs gegen Süleyman Schlacht und Leben. Damit waren die bestehenden habsburgischen Erbansprüche auf Ungarn bedroht, auch Österreich selbst geriet in Gefahr.
Im Oktober 1526 hielt Landgraf Philipp zu Homberg eine Versammlung ab, die die Kirche des Landes neu ordnen sollte. Man verkündete die Einteilung in Pfarrbezirke, von denen ihr Pastor frei gewählt und auch bezahlt werden sollte, und die jährliche Abhaltung einer Synode, wo diese Pastoren mit Nicht-Pastoren aus jedem Pfarrbezirk zur Beschlussfassung zusammenkamen. Philipp mischte sich nicht ein und hieß das gut, denn damit war ein Kirchenaufbau von unten festgelegt, mit der Gemeinde als Keimzelle, wie man es für Luthers Auffassung hielt. 1527 wurde zu Marburg als Ergebnis des in Homberg verabschiedeten Bildungsprogramms eine Universität gegründet.
Luther zögerte mit seiner Zustimmung zum Aufbau der hessischen Landeskirche von unten her, einmal, weil er auch noch zögerte, eine eigene Kirchenorganisation ins Leben zu rufen, zum anderen, weil er, wenn schon dazu geschritten werden sollte, die Autorität der Fürsten dabei für unverzichtbar hielt. Die Pastoren waren von der hessischen Versammlung als „Bischöfe“ bezeichnet worden. Die vorhandenen Strukturen der überkommenen Bistümer, was die geistliche Organisation betraf, mussten ersetzt werden, was bei dem Mangel an qualifiziertem Pastoren-Personal ein ernsthaftes Problem war.
Seinen Kurfürsten bestimmte Luther, mit „Visitationen“ zu arbeiten, um die häufig dürftige Qualität der Geistlichen zu prüfen und zu verbessern, deren Verbindung mit der Seelsorge vor Ort zu festigen, den Kirchenbesitz zu inventarisieren und im Interesse des Landesherrn zu pflegen, denn seit die altgläubige Verwaltung aufgehört hatte, war da mancher Verfall zu beklagen. Die erste kursächsische Visitation dauerte von 1528 bis 1531, die Hessen folgten ihrem Beispiel, die erste Ordination von auf eine einheitliche Lehre hin ausgerichteten Pastoren fand 1535 statt. Luther hatte vom Priestertum aller Gläubigen gesprochen. Aber die Organisation von Seelsorge musste doch professionalisiert werden, damit Luthers Botschaft sich in dem erwünschten Ausmaße und zur Hebung des christlichen Bewusstseins im Volke verfestigte. Nur dass die Professionalisierung, wie sie dann in den Kirchenordnungen vorgeschrieben wurde, zu ihrer Krönung nicht mehr des Sakramentes der Priesterweihe bedurfte.
Die mit dem Bild einer evangelischen Kirchenordnung zu verbindenden Einrichtungen eines Konsistoriums als einer vom Landesherrn eingerichteten, kirchlichen Verwaltungs- und Justizbehörde oder eines Superintendenten für einen bestimmten Kirchenbezirk kamen erst nach dem Augsburger Religionsfrieden (1555) auf. In anderen evangelisch gewordenen Fürstentümern wie Lüneburg, Anhalt, der Markgrafschaft Ansbach, der Grafschaft Ostfriesland, den Herzogtümern Schleswig und Holstein sowie in Mecklenburg wurden ebenfalls Visitationen durchgeführt, auf deren Grundlage man Kirchenordnungen erließ.
Die Monate März und April 1529 sahen einen Reichstag, wiederum in Speyer. Karl V. hatte inzwischen in dem ihm durch die Liga von Cognac (siehe oben) aufgezwungenen Krieg große Erfolge errungen, wenn auch sein abschließender Sieg bei Landriano (Juni 1529, zwischen Pavia und Mailand) sowie der Friede von Cambrai (August 1529) noch ausstanden. Des Kaisers bekanntester Erfolg war der Einmarsch seiner Landsknechte in Rom gewesen (Mai 1527), mit darauf folgender grauenhafter Plünderung, die derart wirkte, dass auch schon behauptet wurde, das spätere, im Unterschied zum frivolen Renaissance-Treiben viel strengere, wenn nicht gar düstere Rom der Gegenreformation hätte aus dieser Verwüstung seinen Ursprung genommen.
Читать дальше