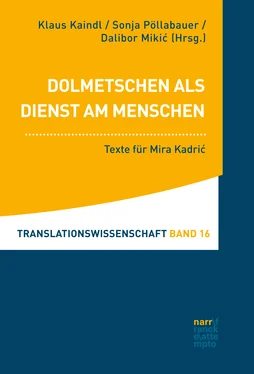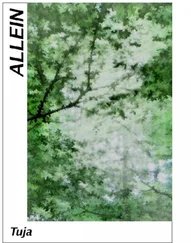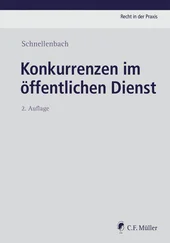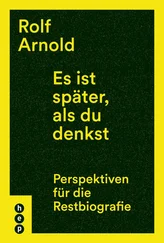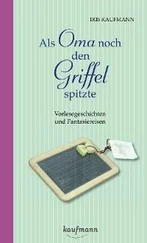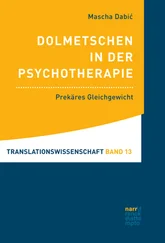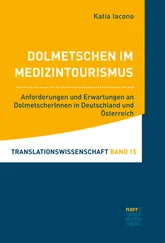Auf die Bedeutung der Mehrsprachigkeit in der EU geht auch Carmen Valero-Garcés in ihrem Beitrag ein. So setzt sie sich konkret mit der Entwicklung der Mehrsprachigkeit am Beispiel der neuen Bedarfssprachen im behördlichen Bereich im letzten Jahrzehnt auseinander. Längst wird nicht nur bei großen Konferenzen gedolmetscht; Mehrsprachigkeit und gedolmetschte Interaktion gehören mittlerweile zum Alltag vieler nationaler Institutionen und Behörden. Dass das Dolmetschen in diesem Bereich immer mehr an Bedeutung gewinnt, zeigt sich besonders im Interesse aktueller dolmetschwissenschaftlicher Beiträge an derartigen Fragestellungen, aber auch in einem größer werdenden spezialisierten Ausbildungs- bzw. Weiterbildungsangebot für das Dolmetschen für Gerichte und Behörden.
2 Im Dialog mit der Gesellschaft
In dieser Sektion stehen die rechtlichen Dimensionen von dolmetschbezogenen Fragestellungen im Mittelpunkt. Aus pragmatischen Gründen entschieden wir, den Zitationsstil der Rechtswissenschaften an die Konventionen der Translationswissenschaft anzugleichen.
Oliver Scheiber setzt sich in seinem Beitrag mit dem Begriff der Würde auseinander, die in Mira Kadrić’ wissenschaftlichem und didaktischem Werk eine treibende Kraft spielt. Scheiber tastet sich an den Begriff der Würde zunächst philosophisch heran, um ihn dann schließlich konkret im Kontext des Gerichts- und Behördendolmetschens zu beleuchten. So zeigt sich die Würde hier unter anderem auch als gleichberechtigte Kommunikation zwischen VertreterInnen von Gerichten und Behörden und fremdsprachigen Personen. Sie zeigt sich aber auch in der Würde der DolmetscherInnen, wenn ihr translatorisches Handeln allparteilich geprägt ist und somit zu einem fairen Prozess beitragen kann.
Alexia Stuefer lässt in ihrem Beitrag „Stimmen“ unterschiedlicher österreichischer Rechtsnormen „zu Wort kommen“, die sich über die Bedeutung der Sprache(n) äußern. So werden beispielsweise Passagen aus der Verfassung und aus der Strafprozessordnung zitiert, in denen der Umgang mit den Minderheitensprachen, der Gebärdensprache aber auch das Recht auf Translationsleistungen thematisiert wird. Im zweiten Teil ihres Beitrags setzt sich Stuefer vor allem mit den österreichischen Rechtsnormen zum Dolmetschen im Strafverfahren auseinander.
Monika Stempkowski und Christian Grafl befassen sich ebenfalls mit dem Dolmetschen im Strafverfahren. In ihrem kriminalpsychologischen Beitrag gehen sie der Frage nach, wie sich das Dolmetschen auf die Lügenerkennung im Strafverfahren auswirkt. VernehmungsexpertInnen machen Lügen nämlich an inhaltlichen Kriterien fest, die durch entsprechende Techniken, wie zum Beispiel durch das kognitive Interview, erhoben werden. Die AutorInnen beschreiben zunächst grundlegende Interviewtechniken und allgemeine Lügenmerkmale, bevor sie auf die potentiellen Schwierigkeiten bei gedolmetschten Vernehmungen übergehen. Vor diesem Hintergrund thematisieren sie auch die Rolle von DolmetscherInnen, heben jedoch gleichzeitig hervor, dass zu diesem Themenfeld noch kaum aussagekräftige Forschungsergebnisse vorliegen.
Richard Soyer stellt in seinem Beitrag die Frage, was juristische Ausbildung leisten kann und soll und beschreibt in diesem Zusammenhang die von ihm initiierten Law Clinics bzw. Rechtsambulanzen an der Karl-Franzens-Universität Graz und an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Soyer geht im Detail auf die Inhalte, den Ablauf und den Mehrwert praxisbezogener Lehrveranstaltungen ein. Resümierend hält er fest, dass durch die Kombination von Theorie und Praxis an Law Clinics und das dort vorherrschende learning by doing bestimmte Sachverhalte für Studierende nachvollziehbarer werden, was wiederum motivierend wirkt. Soyer sieht die Zukunft rechtswissenschaftlicher Curricula an österreichischen Universitäten in einem stärkeren Praxisbezug. Als Beispiel nennt er das Curriculum für das neue Bachelorstudium Rechtswissenschaften an der Johannes-Kepler-Universität Linz, in welchem eine stärkere Verzahnung von Theorie und Praxis vorgesehen ist.
3 Im Dialog mit Lernenden und Lehrenden
Im Dialog mit Lernenden und Lehrenden finden sich Beiträge über die Entstehung eines Lehrbuchs für eine besondere Zielgruppe und über Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote für das Dolmetschen für Gerichte und Behörden.
Christina Schäffners Beitrag handelt vom Entstehungsprozess des noch nicht veröffentlichten Lehrbuchs Interpreting in political and diplomatic contexts – explained , welches in gemeinsamer Autorinnenschaft mit Mira Kadrić und Sylvi Rennert verfasst wurde. Es basiert auf Kadrić’ und Zanoccos Buch Dolmetschen in Politik und Diplomatie (2018). Schäffner thematisiert anhand einiger Beispiele die Probleme bei der Adaption dieses Buchs. Eine große Herausforderung in der englischsprachigen Überarbeitung bestand darin, die Bedürfnisse einer globalen heterogenen LeserInnenschaft zu antizipieren. Die deutschsprachige Version konnte für diese Zwecke nicht einfach übersetzt werden, da sie einerseits einen zu starken Bezug zum DACH-Raum, vor allem Österreich, hatte. Andererseits entspricht beispielsweise der deskriptive Stil des deutschsprachigen Studienbuchs nicht unbedingt den Konventionen und Anforderungen englischsprachiger Lehrbücher, was das Autorinnenteam bei der Adaption berücksichtigen musste.
Ana-Maria Bodo widmet sich in ihrem Beitrag der universitären Weiterbildung am Beispiel des von Mira Kadrić geleiteten postgradualen Universitätslehrgangs Dolmetschen für Gerichte und Behörden , der 2016 an der Universität Wien als Reaktion auf die Flüchtlingskrise 2015/16 eingerichtet wurde. Der Lehrgang wurde zunächst als zweisemestriger Grundlehrgang für die Bedarfssprachen Arabisch, Dari/Farsi und Türkisch angeboten, bis er schließlich 2018 um ein Master-Upgrade erweitert wurde. Mittlerweile werden auch Albanisch und Chinesisch angeboten. Bodo, die nicht nur für das Management des Universitätslehrgangs zuständig ist, sondern bei Mira Kadrić auch eine Dissertation über den Universitätslehrgang schreibt, fokussiert sich in ihrem Beitrag vor allem auf die TeilnehmerInnen, deren Heterogenität – beispielsweise durch die unterschiedlichen beruflichen und akademischen Werdegänge – auffallend ist.
Sylvi Rennerts Beitrag befasst sich ebenso mit der Aus- und Weiterbildung für DolmetscherInnen und NutzerInnen im Rechtsbereich. Rennert gibt zunächst einen Überblick über die verschiedenen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und stellt schließlich das interdisziplinäre DG Justice-Projekt TransLaw an der Universität Wien vor, in dem sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig war. Im Fokus dieses internationalen Projektes stand die Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen DolmetscherInnen und JuristInnen, die beispielsweise in Wien in Form einer transkulturellen LawClinic für Studierende der Translationswissenschaft und der Rechtswissenschaften und eines gemeinsamen Workshops für angehende GerichtsdolmetscherInnen und RichteramtsanwärterInnen durchgeführt wurde.
Vlasta Kučiš‘ Beitrag ist der dritte und letzte Beitrag zu TransLaw , wobei der Fokus auf der Projektimplementierung an der Universität Maribor liegt. Kučiš beginnt mit einer allgemeinen Einführung in die Situation des Gerichtsdolmetschens in Slowenien und beschreibt unter anderem die Zulassungs- und Professionalisierungskriterien für DolmetscherInnen. Danach präsentiert sie die im Rahmen von TransLaw eingeführte Lehrveranstaltung Mehrsprachige und transkulturelle Kommunikation in Strafverfahren , welche in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Translationswissenschaft und der Rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Maribor abgehalten wird.
Читать дальше