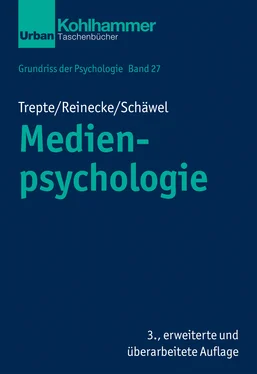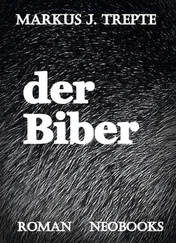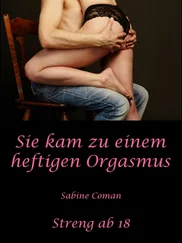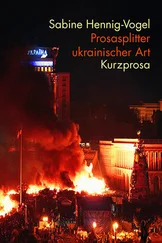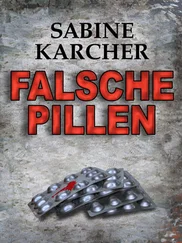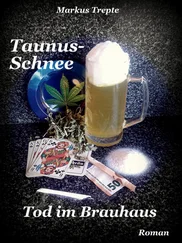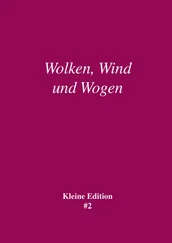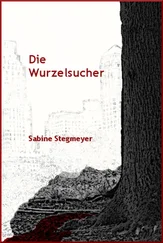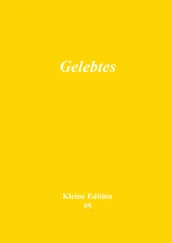Die Forschung liefert in vielen Fällen überraschende Antworten, die mit den Erwartungen der Öffentlichkeit und des Feuilletons brechen. Beispielsweise kann der soziale Vergleich mit erfolgreichen Influencer:innen individuelles Wachstum und Inspiration mit sich bringen, gewalthaltige Computerspiele sind längst nicht so schädlich wie oft vermutet, und Menschen fühlen sich wohler in der Nähe von Robotern, die auch mal zweifeln und eine fehlerhafte Antwort geben. Unser Fach Medienpsychologie hat enorm an Fahrt aufgenommen. Das erhöht die Vielfalt und Qualität der Studien und Theorien sowie im nächsten Schritt auch die Komplexität. Das brachte für uns auch einige Herausforderungen bei dem Verfassen dieses Buches mit sich: Welche neuen Theorien nehmen wir hinzu? Welche Studien wählen wir aus? Wann entscheiden wir uns für Tiefe und wann für eine breite Darstellung? Mit der dritten Auflage des Lehrbuches haben wir kaum einen Stein auf dem anderen gelassen. Geblieben sind Teile der Gliederung und einige Abbildungen, die wir für absolut zentral erachten. Text und Inhalt sind komplett neu. Besonderen Wert haben wir wieder auf die Qualität der vorgestellten Studien gelegt. Wir präsentieren viele Meta-Analysen, Studien mit anspruchsvollen Designs und robusten Ergebnissen und gehen dabei immer wieder auch auf die Forschungsqualität und Limitationen der einzelnen Forschungsfelder ein. Dabei machen wir es Ihnen nicht unbedingt einfach: An vielen Stellen im Buch gibt es keine Universalantworten auf die großen Fragen. Wenn das Forschungsfeld widersprüchliche Ergebnisse hervorgebracht hat, dann werden Sie diesen Widerspruch auch hier im Buch wiederfinden. Wenn eine traditionelle Theorie nicht bestätigt wurde, dann werden Sie das hier lesen. Das ist manchmal herausfordernd, vor allem, wenn ein Buch trotzdem noch innerhalb einer Vorlesung lesbar sein soll. Denn dieses Ziel wollten wir unbedingt aufrechterhalten. Das Lehrbuch Medienpsychologie kann als Lehrbuch innerhalb eines Semesters gelesen und gelernt werden. So machen wir es seit der ersten Auflage an unseren eigenen Universitäten. Darüber hinaus haben wir mit großer Freude festgestellt, dass unser Buch über die grundständigen Studiengänge hinaus auch in Aufbaustudiengängen gelesen wird. Das hat uns ganz besonders gefreut und auch darin bestärkt, dass wir mit dem ersten und zweiten Kapitel viel Kontext geben. Gerade im Hinblick auf die Definitionen von Medien, Kommunikation und Methoden ist dieser Band lesbar ohne ein zusätzliches Nachschlagewerk. Wenn wir eine Methode oder einen methodologischen Begriff nennen, dann erklären wir diese zuvor kurz und knapp im Methodenkapitel. Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit diesem Band, der zwei Themen vereint, die die Menschen umtreiben wie kaum andere Themen: Medien und Psychologie.
Sabine Trepte, Leonard Reinecke & Johanna Schäwel März 2021
Medienpsychologie ist ein lebensnahes Fach, dessen Themen fest im Alltag verankert sind. Die meisten Menschen verbringen täglich viele Stunden damit, das Internet zu nutzen, Zeitung zu lesen und Musik zu hören. Unser gesamter Alltag ist durch die Mediennutzung geprägt, sei es im Beruf oder in der Freizeit. Aus der Mediennutzung resultieren viele Fragen dazu, warum wir bestimmte Medieninhalte auswählen, wie wir uns während der Rezeption fühlen und welche Wirkungen diese Medienangebote auf unser Denken und Handeln haben. All diesen Fragen widmet sich die Medienpsychologie. In diesem Kapitel werden die grundlegenden Definitionen und das Selbstverständnis des Faches Medienpsychologie dargestellt. Hierzu definieren wir zunächst Medienpsychologie ( 
Kap. 1.1 1.1 Was ist Medienpsychologie? Die Bezeichnung Medienpsychologie setzt sich aus dem Begriff »Medien« auf der einen und »Psychologie« auf der anderen Seite zusammen. Mit Medien sind sowohl Massenmedien als auch medienvermittelte bzw. unvermittelte Individualkommunikation gemeint. Massenmedien sind Übertragungskanäle, die Informationen bzw. Inhalte an ein Publikum übermitteln, oder Organisationsformen, z. B. Radio, Fernsehen, Druck- und Pressemedien (Zeitung, Zeitschrift, Buch), Bild- und Tonträgermedien (Kino, Film, CD) oder computervermittelte Medien. Massenkommunikation bezieht sich auf die Kommunikation von und über (1) Inhalte, (2) die kontinuierlich und regelmäßig mithilfe von (3) Medien (4) einer Vielzahl von Personen übermittelt wird (Kunczik & Zipfel, 2005). Diese ist (5) öffentlich und ohne Zugangsberechtigung, (6) einseitig und ohne die Möglichkeit, dass Kommunikator:in und Rezipient:in die Rollen tauschen, sowie (7) ohne direkte Rückkopplung zwischen Rezipient:in und Kommunikator:in. Individualkommunikation bezieht sich auf computervermittelte Kommunikationsmedien (z. B. Smartphone, Computer) oder die nicht-medienvermittelte Interaktion zwischen Menschen (Six et al., 2007). Bei computervermittelten Interaktionen werden Computer oder andere Formen von Informationstechnologie (z. B. Smartphones) verwendet, um eine (indirekte) Interaktion zwischen Personen zu ermöglichen (computervermittelte Kommunikation). Interagieren User:innen nicht miteinander, sondern direkt mit Anwendungen (z. B. Smartphone Apps) bzw. dem Computer, spricht man in der medienpsychologischen Forschung von Mensch-Computer-Interaktion. Die nicht-medienvermittelte Individualkommunikation findet zwischen zwei Menschen (Dyaden) oder in Gruppen statt und wird als Face-to-Face- Kommunikation bezeichnet. Sowohl für die Massen- als auch für die Individualkommunikation spielen Sender:in, Empfänger:in und die vermittelte Botschaft eine Rolle. Mit dem Internet sind außerdem eine Reihe von Schnittmengen zwischen Individual- und Massenkommunikation entstanden. Die öffentlich lesbaren Inhalte auf sozialen Netzwerkseiten entsprechen beispielsweise sowohl den Kriterien der Massenkommunikation als auch denen der computervermittelten Individualkommunikation. Konflikte bringt das nicht nur für die wissenschaftlichen Definitionen, sondern zuweilen auch für die User:innen (Schmidt, 2019). Die Aufgabe der Psychologie ist es, das menschliche Erleben und Verhalten zu beschreiben, zu erklären und zu prognostizieren. Dementsprechend lässt sich die folgende Definition ableiten.
). Im Anschluss daran zeigen wir auf, dass Medienpsychologie auch das Wissen über Medienangebote, über Quoten, Reichweiten und repräsentative Nutzerzahlen beinhaltet ( 
Kap. 1.2 1.2 Medienpsychologie und Medienwissen Medienpsychologie kann nicht ohne Medienwissen sinnvoll verstanden und beforscht werden. Aktuelle Statistiken und Daten zu verschiedenen Zielgruppen basieren teilweise auf großangelegten Studien und sind wertvolle Quellen, um die eigene Forschung (z. B. Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten) vorzubereiten oder auch, um die Ergebnisse medienpsychologischer Forschung einordnen zu können. Um spezifische psychologische Ergebnisse zum Thema Smartphone- oder App-Rezeption wie beispielsweise Involvement, Sucht oder Sexting einordnen zu können, ist es erforderlich zu wissen, wie viele Menschen wie lange ein Smartphone nutzen. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Quellen.
). Wir begründen, warum diese Statistiken und Daten wichtig für die medienpsychologische Forschung sind und stellen die wichtigsten Recherche-Quellen zusammen.
1.1 Was ist Medienpsychologie?
Die Bezeichnung Medienpsychologie setzt sich aus dem Begriff »Medien« auf der einen und »Psychologie« auf der anderen Seite zusammen. Mit Medien sind sowohl Massenmedien als auch medienvermittelte bzw. unvermittelte Individualkommunikation gemeint.
Читать дальше