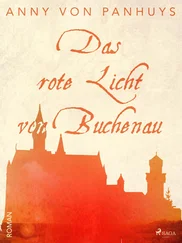Prince fühlte wieder einmal überwältigendes Selbstbewusstsein – nicht nur, weil er James von der Bühne rocken konnte, sondern auch, was seine Karriere insgesamt betraf. Warner Bros. waren ebenfalls sehr zufrieden und waren der Auffassung, dass dieses zweite Album den Grundstein dazu gelegt hatte, ihn zu einem erfolgreichen R&B-Star zu machen. Sie betrachteten ihn als enorm disziplinierten Musiker und auch als entwicklungsfähigen Songwriter; vielleicht hatte das Label ja nun tatsächlich den neuen Stevie Wonder entdeckt.
Die Zukunftspläne von Prince unterschieden sich aber maßgeblich von den Erwartungen seiner Plattenfirma, seiner Manager und auch von denen seiner Mitmusiker. Jetzt, da sich die Siebziger dem Ende neigten, glaubte Prince fest daran, dass die Musik sich ändern würde, und er war bereit, dieser Entwicklung voranzugehen.
3.: Der große Sprung
Obwohl er versuchte, sich als R&B-Musiker zu etablieren, setzte Prince alles daran, nicht in eine bestimmte Schublade gesteckt zu werden. Nur einen Monat nachdem er sein zweites Album abgeschlossen hatte, begann er mit einem Nebenprojekt, in dem er sich deutlicher als je zuvor bemühte, Rockeinflüsse in seinen Sound einzuflechten. Er richtete sich mit seiner Band im Mountain Ears Studio in Boulder, Colorado, ein, und in den folgenden Wochen fanden viele fruchtbare Sessions statt, bei denen sich die anderen Musiker ungewöhnlich stark einbringen konnten; André Cymone und Dez Dickerson steuerten auch eigene Songs bei. Diese Musik, die stark von harten Drumbeats und dicken Schichten verzerrter Gitarren geprägt war, klang völlig anders als die verletzlichen Balladen und Popliedchen von For You und Prince. Ähnlich wie bei dem nicht zu Ende geführten Projekt mit Sue Ann Carwell wollte Prince auch hier ein Album veröffentlichen, ohne seine eigene Beteiligung dabei zu offenbaren. Diese Band, der er den Namen The Rebels gab, wurde für ihn eine Möglichkeit, anonym eine andere Facette seiner künstlerischen Persönlichkeit auszudrücken.
Sein Ausflug in den Rock war jedoch nicht besonders erfolgreich, da die Songs – auch jene, die Prince geschrieben hatte – altbacken klangen und nur wenige interessante Melodien zu bieten hatten. Prince, der dieses Manko erkannte, legte das Projekt einstweilen auf Eis, nachdem sie nach Minneapolis zurückgekehrt waren, obwohl er später einige der Titel wieder aufleben ließ: „You“ wurde beispielsweise später als „U“ neu aufpoliert und an Paula Abdul weitergegeben, die es 1991 für ihr Album Spellbound aufnahm.
Das Album Prince konnte zwar, als es im Oktober 1979 erschien, seine kommerzielle Position stärken, aber es machte ihn unter Rockfans kaum bis gar nicht bekannt. Die Frage blieb: Konnte ein junger, schwarzer Künstler aus dem Mittelwesten aus dem gettoisierten Genre ausbrechen, in das die Plattenindustrie ihn scheinbar zwingen wollte?
Trotz seiner Jugend – als sein zweites Album erschien, war er erst einundzwanzig – war Prince sich des komplizierten Dilemmas, in dem er sich befand, vollständig bewusst. In den Siebzigern hatten die Plattenfirmen die gesamte Musikszene als streng in Schwarz und Weiß getrennt wahrgenommen und diese scharfe Unterteilung zusätzlich gefördert. Es galt als ungeschriebenes Gesetz, dass sich weiße Hörer eher der Rockmusik zuwandten – entweder den härteren Bands wie Kiss, Led Zeppelin und Aerosmith oder aber den sanfteren Ensembles wie Fleetwood Mac, The Eagles und Steely Dan –, während Schwarze eher Funk-Stars wie Chic, Parliament/Funkadelic und Earth, Wind & Fire bevorzugten. Nur sehr selten – Jimi Hendrix bildete die beinahe einzige Ausnahme – wurden afroamerikanische Künstler von den Plattenfirmen als Rock-Acts akzeptiert. Diese Unterteilung im Geschäft reichte bis zu den Angestellten der Plattenfirmen selbst: Zum so genannten Urban Music Department von Warner Bros. gehörte lediglich ein weißer Mitarbeiter, als Prince dort unterschrieb.
„In den Siebzigern war es für einen Weißen extrem unhip, mit einem schwarzen Künstler zu arbeiten“, sagte Howard Bloom, dessen Agentur Anfang der Achtziger die Promotion für Prince übernahm. „Es gab da eine richtige Mauer, und es herrschte eine unglaublich strenge Trennung zwischen Schwarz und Weiß.“
Zwar hatten Mo Ostin und Lenny Waronker großes Vertrauen in sein Talent als R&B-Musiker, aber dennoch erwartete bei Warner oder auch bei anderen großen Labels kaum jemand, dass in nicht allzu ferner Zeit weiße Rockfans ihr Herz für Prince, Michael Jackson und andere schwarze Künstler entdecken würden. Von Anfang an hatte die Plattenindustrie Prince als einen neuen Stevie Wonder oder Smokey Robinson betrachtet, nicht jedoch als eine seltene, an Hendrix erinnernde Persönlichkeit, die Grenzen überschreiten konnte. „Prince wurde als schwarzer Künstler eingestuft“, sagte Bloom, der bei Warner Bros. auf hartnäckigen Widerstand stieß, als er versuchte, diese Einstellung aufzuknacken.
Als das neue Jahrzehnt begann, betrachtete es Prince als immer dringlicher, aus den engen Beschränkungen der Marktnische auszubrechen, in die man ihn gesteckt hatte. Er ging davon aus, dass Siebzigertrends wie Disco allmählich abebbten, und er fürchtete, dass man ihn mit demnächst schon als abgewirtschaftet geltenden Künstlern in einen Topf stecken würde, die lediglich noch für Nostalgieshows gebucht wurden. Außerdem hatte er erkannt, dass seine Single „I Wanna Be Your Lover“ zwar ein Nummer-1-Hit in den Soul-Singles-Charts geworden war, ihm aber noch keine loyale Fangemeinde geschaffen hatte; es war lediglich ein eingängiges Liebeslied, das einem großen Teil des jungen (und vornehmlich weiblichen) Musikpublikums gut gefiel. Wenn er den eingeschlagenen Weg weiterverfolgte, würde er möglicherweise noch einige Hits verbuchen können, sich aber vermutlich nicht als einflussreicher Künstler etablieren.
Während der Prince-Tour gab er sich alle Mühe, sich von den sanften schwarzen Sängern abzuheben, mit denen er so oft verglichen wurde. Er arbeitete nicht nur mit einem ruppigeren Sound, bei diesen frühen Liveshows kamen auch seine Fähigkeiten auf dem typischsten aller Rockinstrumente, der Gitarre, gut zur Geltung. Mit seinen furiosen Soli bewies er, dass er durchaus in die Tradition von Gitarrengöttern wie Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Jeff Beck und anderen gehörte.
Aber es war dennoch etwas anderes, auch beim Songwriting eine rockigere Richtung einzuschlagen. Auf den ersten beiden Alben hatten sich alle Versuche, vom R&B-Pfad abzuweichen, als nicht besonders erfolgreich erwiesen. Rocktitel wie „I’m Yours“ auf For You und „Why You Wanna Treat Me So Bad?“ auf Prince erinnerten an wenig originelle Siebzigerbands wie Boston oder Foreigner, statt sich an wegweisenden Gruppen wie den Rolling Stones oder Pink Floyd zu orientieren. Und die enttäuschenden Ergebnisse der Rebels-Sessions bewiesen erneut, dass er in dieser Hinsicht an seine Grenzen stieß.
Dazu kam, dass das Rockgenre gerade zu der Zeit, als Prince versuchte, seine Stimme als Rockkünstler zu finden, große Veränderungen durchmachte. Zwar blieb das Blues-Rock-Schema von Bands wie den Stones oder Led Zeppelin weiterhin vorherrschend, aber Mitte bis Ende der Siebziger wuchs eine neue Fangemeinde heran, die nach neuen Hörerlebnissen suchte – größtenteils junge Männer, die mit sich und der Welt im Clinch lagen. Diese Musikfans wurden das Kernpublikum der Punkbewegung, die – losgetreten von Bands wie den Sex Pistols und The Clash in England – bald nach Amerika hinüberschwappte. Als Punk allmählich reifer und auch vielseitiger wurde, entstand daraus eine breit gefächerte Richtung, die als Post-Punk oder New Wave bekannt wurde und zu der beispielsweise die Talking Heads, The Police, Devo, Gang of Four, Television oder The Cars gerechnet wurden.
Prince machte sich nach und nach mit diesem neuen Trend vertraut. „Er hatte stapelweise Platten zuhause, die er von Warner umsonst bekommen hatte“, erinnerte sich der Keyboarder Mart Fink. „Er hörte sich einfach alles an.“ Außerdem ging er häufig in Nachtclubs, da er davon ausging, dass man dort am ehesten mitbekam, was gerade neu und angesagt war. In diesen Trendläden entdeckte Prince, dass die Sperrigkeit und der Minimalismus der New Wave allmählich in den Mainstream hineinsickerten.
Читать дальше