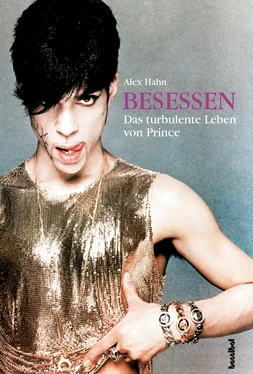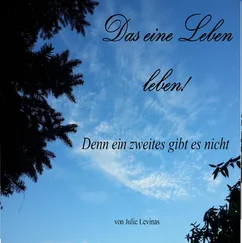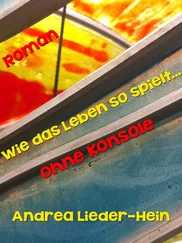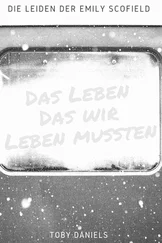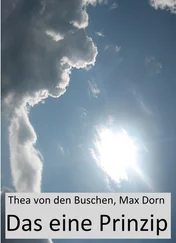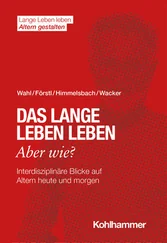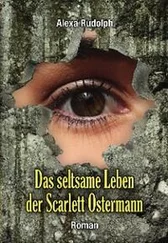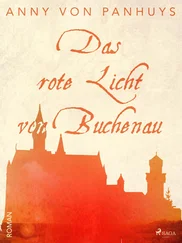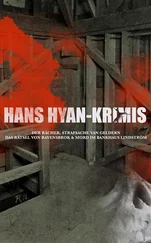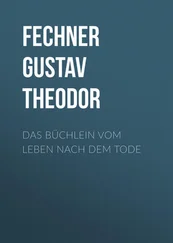Cavallo hatte daraufhin die Idee, Howard Bloom als neuen Publizisten zu engagieren. Er war ein eher rätselhafter Typ, ein energiegeladener, lebhafter Mann, der etwas verschroben wirkte, und einzigartig unter den Rockpresseagenten: Er war ein Akademiker und Intellektueller, der seine Arbeit mit Musikern als eine Art Recherche für sein Steckenpferd, die Untersuchung von Massenphänomenen, betrachtete.
Blooms Vorgehensweise sah so aus, dass er sich mit einem neuen Klienten zu einer Sitzung traf, die an Psychotherapie erinnerte, um die, wie er sie nannte, „Leidenschaftsmomente“ eines Künstlers auszumachen – die inneren Gefühle, in denen die Quelle der Kreativität verborgen liegt. „Ich sagte meinen Künstlern, dass es zum einen ein ‚Du‘ in ihnen gibt, das den ganzen Tag ‚Hallo, wie geht es Ihnen?‘ fragt – eine recht blasse Persönlichkeit“, erinnerte er sich. „Und dann gibt es noch ein anderes Du, das zum Vorschein kommt, wenn man sich mit einem leeren Stück Papier hinsetzt, um einen Text oder eine Melodie zu schreiben. Nach diesem Teil suchen wir.“
Einige Tage bevor die Tour zu Dirty Mind begann, traf sich Bloom nach einer Probe in Buffalo, New York, mit Prince. Er hatte von verschiedenen Seiten gehört, dass sein neuer Klient ein zurückgezogener, arroganter Typ sei, der sich unter keinen Umständen emotional öffnete – was sich alles als falsch herausstellte. Während einer Sitzung, die von zwei Uhr früh bis neun Uhr morgens dauerte, erzählte Prince von seiner turbulenten Kindheit, dem einschneidenden Erlebnis, als er mit fünf Jahren ein Konzert seines Vaters sah, und den Streichen der Teenagerzeit im Keller der Andersons. Als seine „Leidenschaftsmomente“ erkannte Bloom dabei wenig überraschend die Lust nach Ruhm, eine konfliktbeladene Beziehung zu beiden Elternteilen und einen unersättlichen Hunger nach Sex.
Als die Tournee am 9. Dezember 1980, einen Tag, nachdem John Lennon erschossen worden war, im angesagten Ritz in Manhattan Station machte, war der Raum nur etwa zur Hälfte gefüllt, aber dass sich unter den Zuschauern Größen wie Andy Warhol, der Funk-Produzent Nile Rogers und die Sängerin Nona Hendryx befanden, zeigte bereits, dass Prince sein Potenzial weiter vergrößert hatte. „Die Stimmung in dem Raum war überwältigend“, erinnerte sich Bennett. „Das war der Punkt, an dem wir dachten: Jetzt geht’s ab!“ Aber als man in Orte wie Charleston, Chattanooga oder Baton Rouge weiterzog, wurde das Publikum immer kleiner, und man beschloss, die Tour durch die südlichen USA zu kürzen. Auch landesweit verkaufte sich das Album nur schleppend.
Selbst Prince begann nun zu zweifeln. Als sie nach Minneapolis zurückgekehrt waren, lud er Dickerson in ein indisches Restaurant zum Abendessen ein und zeigte nun dieselben Bedenken, die auch Warner Bros. über seine neue Richtung geäußert hatten. „Er nutzte mich als Resonanzkörper, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob an dem, was diese Leute sagten, etwas dran war oder nicht“, sagte Dickerson. Da er ihn einerseits beruhigen wollte, andererseits aber auch an die Richtung von Dirty Mind glaubte, beteuerte der Gitarrist, Prince solle sich keine Sorgen machen. „Ich glaubte wirklich, dass wir etwas entdeckt hatten, das noch nie jemand zuvor umgesetzt hatte“, sagte er.
Howard Bloom, der ebenso fest an Prince glaubte, brachte mehrere Zeitschriften dazu, über Prince zu berichten. Und der Ball kam endlich ins Rollen, als der Rolling Stone im Februar 1981 einen Artikel brachte, der mit der Zeile „Ob die kleinen Mädchen das verstehen?“ überschrieben und von einer überschwänglichen Kritik zu Dirty Mind begleitet war. „In seinen besten Momenten ist Dirty Mind absolut versaut“, schrieb Ken Tucker. „Sein hinterlistiger Witz, der absichtlich so unanständig ausfällt, ist im Grunde ein frühzeitiger, direkter Aufruf zum Widerstand gegen den elitären Puritanismus der Reagan-Ära.“ Mit dieser Kritik kam die gesamte Werbekampagne für das Album in Schwung, denn nun wurden andere einflussreiche Zeitschriften auf Prince aufmerksam. Der New Musical Express schrieb beispielsweise: „Auf ähnlich selbstbewusste Weise wie Sly Stone und George Clinton vor ihm setzt auch Prince alles daran, innerhalb der klischeebeladenen Grenzen schwarzer Dance-Musik neue Ufer zu erreichen.“
In wichtigen Szenestädten wie New York und Detroit kletterten die Verkaufszahlen für das Album und für Konzerttickets nun nach oben. Eine sehr heterogene Gruppe von Fans – Schwarze, Weiße, Schwule und eine nicht unbedeutende Zahl von Transvestiten – tauchte nun bei Prince-Konzerten auf und bewies, dass die populistische, pansexuelle Botschaft von Dirty Mind angekommen war. Die Platte war kein Überflieger (und kam nicht einmal annähernd an den Erfolg von Prince heran), aber Prince hatte sich einem wichtigen neuen Publikum aus Kritikern und Trendsettern vorgestellt.
Diese Aufmerksamkeit hatte er sich verdient: Prince hatte seinen Sound auf Dirty Mind erfolgreich neu definiert. Mit seinen knapp dreißig Minuten Spielzeit bietet das Album einen flotten, energiegeladenen Ritt mit vielen Highlights, darunter das heftige und hypnotische „Head“, das von Blues und Gospel geprägte „Partyup“ und der Popklassiker „When You Were Mine“. Und nicht nur der raue, gitarrenlastige Sound war eine einschneidende Veränderung im Vergleich zu den Vorgängeralben, bei den Texten zeigte sich dasselbe Bild. Sogar dann, wenn er sich mit den dunkleren Seiten seiner Sexualität beschäftigte, schien sich Prince zu einem politischen Künstler zu entwickeln; die Antikriegshymne „Partyup“ knüpft an die Protestlieder der Sechziger an, und „Uptown“ beschreibt ein Utopia der Gegenkultur, in dem sich Menschen verschiedener Rassen unter dem Banner sexueller Freiheit vereinigen.
Doch das Bemerkenswerte an Dirty Mind ist letztlich nicht die Tatsache, dass sein Stil hier perfekt umgesetzt war, sondern dass es einen Kreativitätsfluss in Gang setzte, der ihn für gewisse Zeit zum einflussreichsten Künstler des Pop machte. Betrachtet man die Entwicklung der Musikszene während der Achtziger-, Neunzigerjahre und darüber hinaus, dann war Dirty Mind insofern prophetisch, als es den Übergang von den polierten, bombastischen Sounds der Siebziger hin zu einer strafferen, kompakteren Ästhetik markierte. Zwei Jahrzehnte später arbeiteten Künstler wie Macy Gray oder D’Angelo noch immer mit der Soundgrundlage, die Prince mit diesem Album geschaffen hatte. Prince, wiewohl damals knapp über zwanzig, hatte bereits neue Wege in der Popmusik aufgezeigt.
Obwohl in den Credits zu Dirty Mind steht, dass das Album zur Gänze von Prince geschrieben wurde (mit Ausnahme des Titelsongs, bei dem er mit Matt Fink als Autor angegeben ist), wurde diese Angabe bei zwei der acht Songs angezweifelt. Über „Partyup“ hieß es vielfach, dass die Musik (wenn auch nicht der Text) von seinem langjährigen Freund Morris Day geschrieben wurde, der in seiner ersten Band als Schlagzeuger dabei war. Im Sommer 1980 spielte er Prince einen Groove vor, den er aufgenommen hatte, und Prince schrieb sofort einen Text dazu und baute den Song zu „Partyup“ um. Anschließend machte er Day ein Angebot: Er wollte ihm entweder zehntausend Dollar für den Song bezahlen oder aber ein Nebenprojekt mit Day gründen. Day entschied sich für Letzteres, und das gab Prince nach der Auflösung der Rebels die Möglichkeit, die Musik, die in rapider Geschwindigkeit aus ihm herausströmte, noch an anderer Stelle unterzubringen.
„Uptown“, der zweite umstrittene Song von Dirty Mind, basiert angeblich auf Musik von André Cymone. „Der Bassmelodie des Titels lag eine Idee zugrunde, die André beim Jammen während einer Probe entwickelte“, sagte Dickerson dem Prince-Biografen Dave Hill. (Auch Charles Smith bestätigte das.) Zudem erinnerte sich Pepé Willie, der mit Prince und Cymone 1979 Aufnahmen machte, dass die Musik von „Do Me, Baby“, das später auf dem 1982 erschienenen Album Controversy enthalten war, bei einer dieser Sessions ebenfalls von Cymone erstmals gespielt wurde. Als Controversy erschien, bat Cymone erzürnt Willie um Beistand. „Ich sagte André, er hätte sich das Copyright dafür eintragen lassen sollen und dass ich nichts tun könnte.“
Читать дальше