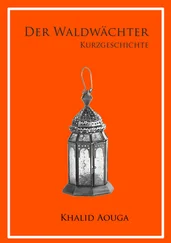Einige Zeit später, als meine Eltern einmal für ein Wochenende fortfuhren, bemerkte ich, dass Vater vergessen hatte, die Schublade abzuschließen. Nachdem meine Geschwister schlafen gegangen waren, öffnete ich leise die Schublade und fand zu meiner Überraschung tatsächlich den Füller. Das Gefühl, ihn in meinen eigenen Händen zu halten, war unbeschreiblich; es war mehr, als ich aushalten konnte. Ich brach in Schweiß aus. Ich entnahm ihn der Schublade, schraubte die obere Hälfte ab, untersuchte den goldenen Bügel, die Goldverzierung und die Initialen HG zwischen zwei schmalen Ringen. Der Füller war geformt wie eine dünne Zigarre. Ja, ein Kunstwerk.
Aus meinem Notizbuch riss ich eine Seite heraus und fing an, meinen Namen zu schreiben, dann die Namen meiner Geschwister. Zuerst schien alles etwas unförmig, aber nach einer Weile trieb ich es so weit, zu versuchen, die Unterschrift meines Vaters nachzumachen, was ziemlich unleserlich und abstrus ausfiel. Wie ich so die Seite vollschrieb, stellte ich fest, dass die Art und Weise, wie der Füller funktionierte, nichts Ungewöhnliches an sich hatte. Vielleicht war die Federspitze weicher und biegsamer als die meines Schulfederhalters, und deshalb erzeugte sie eher so etwas wie eine kalligraphische Wirkung. Ich riss noch eine Seite heraus und übte mich in noch mehr Kalligraphie. Wie die aussehen sollte, davon hatte ich nur eine vage Vorstellung. Bald wurde ich müde und schläfrig. In der Hoffnung, Vater würde nichts herausbekommen, säuberte ich den Füller und deponierte ihn wieder in der Schublade, wie ich ihn vorgefunden hatte.
Es war fast Mitternacht und Vollmond. Außer dem Summen einer Fliege, die gegen die Fensterscheibe prallte, war es still im Haus. Durch das Schlafzimmerfenster konnte ich die angrenzenden Dächer sehen, mit einem Haufen seltsam anmutender schmaler Schornsteine, die von runden metallenen Helmen gekrönt waren, welche das Mondlicht schwach widerspiegelten.
Es hatte etwas Groteskes.
Ich fasste den Entschluss, die Seite mit meinen kalligraphischen Übungen aufzuheben, um sie meinem Freund Saul zu zeigen. Ich wollte mit ihm gerne quitt sein und ihm beweisen, dass auch ich meines Vaters Füller, wann ich nur wollte, benutzen durfte. Als ich ihm das Blatt brachte, war Saul mitnichten beeindruckt. „Das soll Schönschrift sein? Und mit einem Füller geschrieben?“ fragte er nach. „Es sieht aus, als hätte es ein Huhn hingekritzelt,“ sagte er.
Ich war gekränkt. Es hörte wohl nie auf: Sauls Bemühungen mussten immer erfolgreicher sein als meine, und ich konnte nicht verstehen, warum. Ich wünschte mir, mich an ihm auf die schlimmste Weise zu rächen und ihm zu beweisen, dass ich genauso gut war wie er.
Die Zeit verging, und die Gelegenheiten, den Füller zu benutzen, wurden weniger, besonders nachdem Vater es sich zur Gewohnheit machte, die Schublade doch immer abzuschließen. Ich durfte an das gute Stück einfach nicht mehr denken.
Ein paar Jahre später, 1939, brach der Zweite Weltkrieg aus, und die Nazis besetzten unsere Stadt. Im April 1941 mussten wir unsere Wohnung mit allem, was darin war, aufgeben und in ein neu geschaffenes Ghetto ziehen. Mein Vater hatte nicht die geringste Chance, den Inhalt seiner Schublade mitzunehmen; alles einschließlich des Füllers musste zurückgelassen werden. Es war kaum genug Zeit, auch nur das Nötigste zusammenzusuchen, vor allem Kleidung. Die Gestapo konfiszierte die Wohnung mit allem Inventar. Es tat mir leid, dass Vater seinen Füller verlor, aber es gab Wichtigeres, worum man sich Sorgen machen musste. Es war ja unser Leben, das in ständiger Gefahr schwebte.
In dieser Zeit machte ich eine Lehre in einem Fotostudio, das Herrn Orenstein gehörte, einem Freund der Familie. Er erledigte Bildbearbeitungen für die Gestapo. Bei dieser holte ich regelmäßig Negative und lieferte sie ihnen retuschiert wieder ab. Eines Tages im Winter 1941/42, während ich bei der Gestapo auf Negative wartete, kam ein großgewachsener Offizier mit Narben im Gesicht herein und fragte den Gestapo-Fotografen Helmut Reiner, ob er jemanden kenne, der Füllfederhalter repariere. „Natürlich“, antwortete Reiner, „zufällig kenne ich im Ghetto einen Juden, der so etwas macht. Er repariert auch wertvolle Uhren. Er ist sehr gut und recht billig.“
Der Offizier zog einen Füller aus der Tasche und übergab ihn Reiner. „Ich wäre dankbar, wenn Sie das für mich erledigen könnten. Ich glaube, die Pumpe leckt,“ sagte er.
Von da aus, wo ich saß, konnte ich den Füller sehen. Er war schwarz und mit Blattgold verziert wie der meines Vaters. Ich war verblüfft. Der Offizier hinterließ den Füller bei Reiner und marschierte wieder hinaus. Konnte dies tatsächlich der Füller meines Vaters sein?, fragte ich mich. Reiner steckte ihn in seine Tasche und ging ins Hinterzimmer. Ein paar Minuten später erschien er mit einer Schachtel, darin die Negative. „Also“, sagte er, „hier sind die Negative für Herrn Orenstein. Aber ich hab auch noch etwas anderes, was du bitte für mich tun sollst, und zwar sollst du ein Päckchen bei einem Herrn Goldschlager abgeben, der auch im Ghetto wohnt. Das dürfte ja nicht schwierig sein. Instruktionen für ihn lege ich bei. Sei vorsichtig und verliere es nicht. Es ist ein sehr teurer Füllfederhalter darin, und der gehört nicht mir. Er gehört meinem Vorgesetzten, Obersturmführer Heinz Gahr.“ Reiner steckte den Füller mit den Instruktionen in einen braunen Umschlag, versiegelte diesen und übergab ihn mir. „Ich werde sehr vorsichtig sein, Herr Reiner,“ sagte ich.
Mein Herz schlug heftig, als ich sein Büro verließ. Das Päckchen steckte ich in meine Brusttasche, so dass ich den Füller an meiner Brust spüren konnte. Es war ein langer Weg zurück zu Herrn Orensteins Studio. Sobald ich um die Ecke bog, war ich versucht, das Päckchen zu öffnen und den Füller genauer zu untersuchen, aber ich entschied mich dagegen. Man stelle sich vor, jemand folgte mir. Schließlich war es ein Handel mit der Gestapo, und das allein war für mich schon erschreckend genug. Jedes Mal wenn ich eine Straße zu überqueren hatte, hielt ich eine Sekunde an und befühlte die linke Seite meiner Brust, um mich zu vergewissern, dass das Päckchen noch in meiner Tasche war. Als ich im Studio ankam, war ich mit den Nerven am Ende. Ich übergab Herrn Orenstein nur noch die Negative und zog mich in die Werkstatt zurück.
Das Päckchen wollte ich nach Feierabend auf meinem Heimweg abliefern. Vor lauter Angst, es könne sonst aus der Tasche fallen, behielt ich meine Jacke an. Gott schütze mich, dachte ich, wenn dem Füller etwas passierte. War es möglich, dass es sich um den meines Vaters handelte?, fragte ich mich immer wieder. Und was, wenn er es wäre? Wie konnte ich dann irgendetwas in der Sache tun? Schließlich, so argumentierte ich durchaus logisch, war der Füller meines Vaters nicht der einzige schwarze, goldgeprägte auf der Welt.
Die Szene, wie Herr Ginzburg sich von meinen Eltern verabschiedete, kam mir wieder in den Sinn. Zehn Jahre waren seitdem vergangen. Ich hätte gerne gewusst, wie es ihm in Palästina inzwischen ergangen war. Ich konnte mir ausmalen, wie er, mit der sengend heißen Sonne im Rücken, in Gummistiefeln in einem Graben stand und Sümpfe trockenlegte. Wenn der wüsste, was seinem Füller passiert war, dachte ich.
Es war schon nach Einbruch der Dunkelheit und Zeit, den Heimweg anzutreten. Als ich losging, fing es an zu regnen, und ein böiger Wind trieb mich die Gehwege entlang vor sich her. Völlig durchnässt schaffte ich es bis ins Ghetto und fand das Haus, in dem Herr Goldschlager wohnte.
Читать дальше