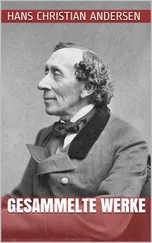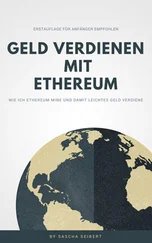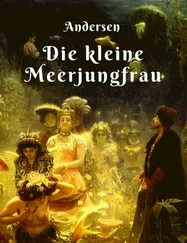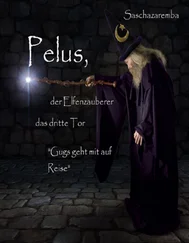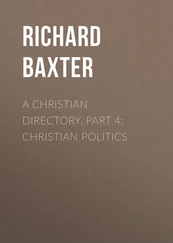Der Gläubiger ist gem. § 885a Abs. 4 ZPO berechtigt, die von ihm verwahrten Sachen zu verwerten, wenn der Schuldner die Sache nicht innerhalb einer Frist von einem Monat nach der Besitzeinweisung des Gläubigers herausverlangt („abfordert“). Anders als die Konstruktion der „Berliner Räumung“ regelt die Vorschrift des § 885a Abs. 4 S. Z ZPO die Verwertung der vom Gläubiger verwahrten Sachen. Die Vorschrift verweist hierzu auf die §§ 372 ff. BGB. Danach sind Geld, Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie Kostbarkeiten zu hinterlegen 110) ; ist die Sache zur Hinterlegung nicht geeignet, so hat der Vermieter die Sache zu versteigern und den Erlös zu hinterlegen. 111) Eine Besonderheit besteht bezüglich der Sachen, an denen der Vermieter ein Vermieterpfandrecht nach § 562 Abs. 1 BGB geltend gemacht hat. Diese Gegenstände sind nach den §§ 1257, 1228 ff. zu verwerten. 112) Der Vermieter ist berechtigt, nicht verwertbare Sachen zu vernichten. 113)
Die Regelung des § 885 Abs. 3 Satz 3 ZPO normiert zu Gunsten des Vermieters eine deutliche Haftungserleichterung. Danach hat der Vermieter für die Entfernung und Verwahrung der beweglichen Sachen des Mieters nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Werden die beweglichen Sachen des Mieters bei der Auswahl, der Entfernung oder Verwahrung beschädigt, hat der Vermieter diesbezüglich nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Der Vermieter wird bspw. Ersatz für Transportschäden leisten müssen, wenn diese auf eine nicht fachgerechte Verpackung der Gegenstände (z. B. Porzellan, Glas) zurückzuführen sind.
Die Neuregelung in § 885a Abs. 7 ZPO ermöglicht es dem Vermieter nunmehr, die Kosten nach den Absätzen 3 und 4 als Kosten der Zwangsvollstreckung gem. § 788 Abs. 2 ZPO gegen den Schuldner festsetzen zu lassen.
Der Gerichtsvollzieher hat nach § 885a Abs. 6 ZPO die Pflicht, den Gläubiger und den Schuldner mit der Mitteilung des Räumungstermins 114) auf die Bestimmungen der Absätze 2 bis 5 hinzuweisen.
Im Rahmen der „klassischen“ Herausgabevollstreckung nach § 885 ZPO wird insbesondere der Personenkreis erweitert, der zur Entgegennahme der vom Mieter zurückgelassenen Sachen berechtigt sein soll. Mit der Neuregelung will der Gesetzgeber der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung tragen, dass viele Mieter alternative Formen des Zusammenlebens (z. B. Wohngemeinschaften) bevorzugen. Nach Ansicht des Gesetzgebers begründet das Merkmal des gemeinsamen Zusammenwohnens ein besonderes Vertrauensverhältnis, das zur Entgegennahme persönlicher Gegenstände berechtigt. 115)
Nach der neuen Regelung des § 885 Abs. 2 ZPO können bewegliche Sachen, die vom Gerichtsvollzieher aus der Wohnung zu entfernen („wegzuschaffen“) sind nicht nur dem Schuldner bzw. in dessen Abwesenheit einem Bevollmächtigten oder erwachsenem Familienangehörigen des Schuldners übergeben oder zur Verfügung gestellt werden, sondern nunmehr auch einem erwachsenem ständigem Mitbewohner des Schuldners.
§ 885 Abs. 3 ZPO stellt in Anlehnung an die bisherige Rechtspraxis 116) klar, dass der Gerichtsvollzieher die in § 885 Abs. 2 ZPO bezeichneten Sachen auch dann aus der Wohnung entfernen und einlagern darf, wenn der Schuldner oder die in Absatz 2 bezeichneten Personen die Entgegennahme verweigern.
Den Begriff des „Pfandlokals“ in § 885 Abs. 2 BGB a.F. hat der Gesetzgeber durch den „für die Verwahrung der Sachen geeigneteren Begriff der „Pfandkammer“ ersetzt. 117)
Bewegliche Sachen, an deren Aufbewahrung offensichtlich kein Interesse besteht, sollen unverzüglich vernichtet werden. Ein solches Interesse kann grundsätzlich bei gewöhnlichem Abfall und Unrat angenommen werden. 118) Dies gilt nach den Gesetzesmaterialen allerdings nicht für „wertlose oder im gegenwärtigen Zustand nicht (mehr) gebrauchsfähige Sachen, deren weitere Verwendung durch den Schuldner bei Betrachtung durch einen objektiven Dritten nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann.“ 119)
Nach dem neuen § 885 Abs. 5 ZPO sind unpfändbare Sachen 120) und solche Sachen, bei denen ein Verwertungserlös nicht zu erwarten ist, auf Verlangen des Schuldners jederzeit ohne weiteres herauszugeben. Der Inhalt der Vorschrift entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung des § 558 Abs. 3 Satz 2 ZPO.
Verlangt der Schuldner die (eingelagerten) Sachen nicht binnen einer Frist von einem Monat nach der Räumung heraus („abfordern“), so hat der Gerichtsvollzieher die Sachen zu verkaufen und den Erlös zu hinterlegen. Nach der bisherigen Regelung des § 885 Abs. 4 S. 1 ZPO a. F. hatte der Schuldner noch zwei Monate Zeit die Sachen herauszufordern. Die Fristverkürzung dient der Harmonisierung mit der neuen Regelung des § 885a Abs. 4 S. 1 ZPO 121) sowie einer effizienteren Gestaltung des Vollstreckungsverfahrens. Der Gerichtsvollzieher hat die Sachen trotz fristgerechter „Abforderung“ zu verwerten, wenn der Mieter nicht innerhalb einer (weiteren) Frist von zwei Monaten nach der Räumung die Kosten für den Transport und die Einlagerung der Sachen begleicht. 122)
Die Verwertung hat durch öffentliche Versteigerung zu erfolgen Die neue Regelung des § 885 Abs. 4 Satz 3 ZPO erklärt nunmehr die Vorschriften der §§ 806, 814, 817 ZPO ausdrücklich für entsprechend anwendbar. Nach §885 Abs. 4 Satz 4ZPO sollen die Sachen, die nicht verwertet werden können, vernichtet werden.
Kündigungsschutz bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen
Der Vermieter kann das Mietverhältnis bei Eigenbedarf oder Hinderung einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung unter den Voraussetzungen des § 573 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 BGB kündigen. Eigenbedarf kann der Vermieter für sich geltend machen, wenn er die Räume selbst als Wohnung nutzen will. Bei mehreren Vermietern genügt es, wenn der Eigenbedarf für nur einen von ihnen besteht. 123) Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG), juristische Personen (GmbH, AG) und Vereine können als solche keinen Wohnbedarf haben. 124) Da es aber nicht gerechtfertigt erscheint, die Gesellschafter einer GbR schlechter zu stellen, als die Mitglieder einer einfachen Vermietermehrheit, kann die Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach geltender Rechtspraxis das Mietverhältnis bei Eigenbedarf eines Gesellschafters kündigen. 125)
Der Erwerber einer Wohnung tritt mit Vollendung des Eigentumserwerbs, also i. d. R. mit der Eintragung ins Grundbuch, gem. § 566 Abs. 1 BGB kraft Gesetz in das bestehende Mietverhältnis ein, das er sodann unter den Voraussetzungen des § 573 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 BGB kündigen kann. Hat der Vermieter an den Wohnungen eines Mehrfamilienhauses Wohnungseigentum begründet 126) und die Wohnungen anschließend veräußert, so wird das Recht des Erwerbers zum Ausspruch einer Eigenbedarfs- oder Verwertungskündigung gem. § 577a Abs. 1 BGB für die Dauer von drei Jahren beschränkt. Eine Kündigung innerhalb der Frist ist in jedem Fall unwirksam. Die Sperrfrist kann in Gebieten mit besonderer Gefährdung der Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen auf bis zu zehn Jahren festgesetzt werden. Die Bundesländer werden in § 577a Abs. 2 Satz 2 BGB ermächtigt, die Gebiete und die Frist nach § 577a Abs. 2 Satz 1 BGB für die Dauer von höchstens zehn Jahren durch Rechtsverordnung zu bestimmen. Der Tatbestand des § 577a Abs. 1 BGB setzt in zeitlicher Reihenfolge zunächst den Abschluss eines Mietvertrages, die Einräumung von Besitz, die Begründung von Wohnungseigentum und schließlich die Veräußerung der Eigentumswohnung voraus.
Nach der bisherigen Rechtslage war es möglich, die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 577a Abs. 1 BGB unter Beteiligung einer Personengesellschaft/Personenmehrheit zu umgehen. Im Rahmen dieser Konstruktion wurde das Mehrfamilienhaus zuerst an eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts veräußert. Anschließend hat die GbR die Mietverhältnisse gem. § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB wegen Eigenbedarfs ihrer Gesellschafter gekündigt. Nach Beendigung der Mietverhältnisse wurde sodann Wohnungseigentum begründet (sog. „Münchener Modell“).
Читать дальше