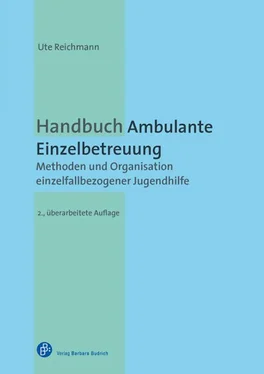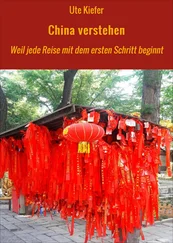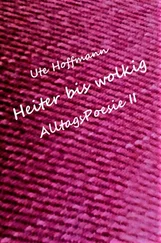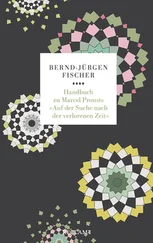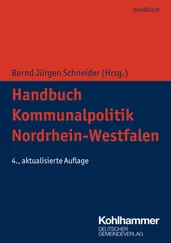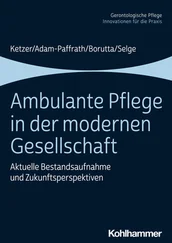Jede ambulante Einzelbetreuerin und jeder ambulante Einzelbetreuer muss einen eigenen Weg suchen, persönliche Nähe und professionelle Distanz zu verbinden. Leicht auflösen lässt sich dieser Widerspruch zwischen einem kühl-abwägenden, professionellen Blick und der Lebensweltnähe zu den Adressatinnen und Adressaten, der Orientierung an ihren Bedürfnissen, Wünschen und Zielen und einem vertrauensvollen Umgang mit ihnen nicht.
Die Problemlagen in der ambulanten Einzelbetreuung
Ambulante Einzelbetreuung wird selten problemspezifisch eingesetzt. In vielen Fällen bilden die Problemlagen zu Beginn der Hilfe eine diffuse und undurchsichtige Anhäufung einander verstärkender Schwierigkeiten, bei denen ein Ansatz für Veränderung[41] kaum erkennbar ist. Die Beteiligten drängen auf Unterstützung, weil es „so“ nicht weiter gehen kann. Die Eingangssituation ist durch Sachzwänge – ein drohender Schulverweis, der unbedingt abgewendet werden soll, eskalierte Konflikte, eine zugespitzte Drogenproblematik oder eine drohende Haftstrafe – dominiert. Daraus resultiert ein starker Handlungsdruck. Die Gefahr einer an schneller Entlastung orientierten und wenig inhaltlichen Hilfeindikation ist dann groß. Vielleicht wären weiter gehende Hilfemaßnahmen sinnvoller. Dafür konnte man aber weder die Eltern noch den jungen Menschen gewinnen. Eventuell war vor Ort kein geeignetes Gruppenangebot vorhanden, der junge Mensch schien zu alt für die sozialpädagogische Familienhilfe oder die Eltern stimmten dem Hilfeangebot nur deshalb zu, weil sie sich davon Erleichterung versprachen. Ambulante Einzelbetreuung wäre somit ein Kompromiss, der kleinste gemeinsame Nenner oder – das wäre die ungünstigste Variante – die Hilfeform, von der die Beteiligten annehmen, dass sie ihnen am wenigsten Engagement abverlangt. Dies kann auch für den Verhandlungspartner Jugendamt gelten: Ambulante Einzelbetreuung ist wegen der verhältnismäßig geringen Kosten und des geringen internen Begründungsaufwands leichter durchsetzbar als andere Hilfen.
Zielgruppe
Abgesehen von der Betreuungsweisung, die ein spezifisches Angebot für straffällige Jugendliche darstellt, wird ambulante Einzelbetreuung relativ alters- und zielgruppenunspezifisch eingesetzt – bei einer Präferenz für (männliche) Jugendliche.
Auf der Ebene der Hilfeindikation findet also kaum problembezogene Selektion statt. Nach welchen Kriterien die Allgemeinen Sozialdienste eine Abgrenzung der verschiedenen Hilfeangebote leisten ist unbekannt. Wünsche beziehen sich häufig auf persönliche Eigenschaften und Kompetenzen der einzusetzenden Betreuungspersonen wie Geschlecht, Alter oder bestimmte Kompetenzen und Interessen. So ist vor allem ab Vorpubertät eine gleichgeschlechtliche Kombination von Betreuungspersonen und betreuten jungen Menschen üblich. Dies wird damit begründet, dass Betreuerinnen und Betreuer des gleichen Geschlechts eine Vorbildrolle hinsichtlich der Geschlechtsrollenidentität einnehmen und bei sexuellen Fragen als Beraterinnen und Berater fungieren können. Gleichgeschlechtliche Zusammensetzungen gelten in der Beziehungsarbeit als wirksamer und unproblematischer. Auch ein eigener Migrationshintergrund, zum Fall passende spezielle sprachliche oder fachliche Kompetenzen und besondere professionelle Vorerfahrungen spielen häufig bei der Einsatzentscheidung einer bestimmten Person in einem bestimmten Fall eine Rolle. Das Alter der Betreuungsperson und persönliche Charakteristika und Interessen können ausschlaggebend sein. Dass die individuelle „Passung“ von Betreuungsperson und betreutem jungen Mensch die Wirkung der Hilfe erheblich bestimmt, ist in der Fachliteratur unumstritten (vgl. Fröhlich-Gildhoff 2003, Rätz-Heinisch 2005). Ein Problem stellt aber nach wie vor die mangelnde Greifbarkeit der Faktoren dar, die eine persönliche Passung ermöglichen.
Funktion der Hilfe
Ambulante Einzelbetreuung ist multifunktional. Maßnahmen nach § 30 und § 35 SGB VIII vereinigen Sozialisations-, Bildungs-, Unterstützungs-, Kontroll- und – bei Betreuungsweisungen[42] anstelle strafrechtlicher Sanktionen – auch Resozialisierungsfunktionen. Diese Funktionen sind nicht klar voneinander abzugrenzen.
Der Unterstützungsgedanke steht bei allen Jugendhilfemaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz im Vordergrund. Dies beinhaltet Freiwilligkeit und Partizipation bei der Hilfeplanung. Obwohl das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) den Partizipationsgedanken auch für Minderjährige stärkt, ist er noch nicht befriedigend umgesetzt, weil Minderjährigen nach wie vor kein eigenes Antragsrecht auf Jugendhilfemaßnahmen zukommt (vgl. Urban 2004, Münder 2006, Pluto 2007). Beantragen Eltern eine ambulante Einzelbetreuung „für“ einen jungen Menschen, die von ihm abgelehnt wird, kann die Hilfe aus seiner Sicht als unfreiwillig, erzwungen und gegebenenfalls als Kontrollmaßnahme erscheinen.
Kontroll- und Eingriffsaufgaben gehören vor allem dann zum Pensum ambulanter Einzelbetreuungen, wenn ein Verdacht der Kindeswohlgefährdung aufkommt (s. Kap. Grenzsituationen der Jugendhilfe: Kindeswohlgefährdung).
Sozialisationsaufgaben stehen bei einem familienergänzenden Einsatz an erster Stelle. Dies gilt nicht nur für die Betreuung kleinerer Kindern, sondern kann auch bei Jugendlichen erforderlich sein, die durch Vernachlässigung und Alltagsstrukturprobleme altersentsprechende Kompetenzen nicht erworben haben.
Auch die Vermittlung von Bildungsinhalten kann zum Aufgabenbereich der ambulanten Einzelbetreuung gehören, zum Beispiel, um in der Schule den Anschluss wieder zu ermöglichen.
Diese vielfältigen Funktionen sind in der Praxis nicht zu trennen. Typisch für natürliche soziale Kontexte ist immer eine gewisse Rollen- und Funktionsmischung. Dies gilt auch für die kontroll- und unterstützungsorientierten Anteile der Arbeit. Freiwilligkeit zu Beginn eines Jugendhilfeangebots erhöht möglicherweise die Kooperationsbereitschaft. Aber das Entstehen einer konstruktiven Arbeitsbeziehung wird durch eine Zwangs- und Eingriffsstruktur nicht automatisch verhindert.
Gerade der auf den ersten Blick unproblematische Unterstützungsaspekt einer Jugendhilfemaßnahme kann für Jugendliche, die Wert auf Eigenständigkeit und Unabhängigkeit legen, unakzeptabel erscheinen. Ein junger Mensch kann es als Ausdruck persönlichen Versagens und Bedrohung von Souveränität empfinden, wenn ihm in der Hilfeplanung die Formulierung eines expliziten persönlichen Hilfebedarfs abverlangt wird. So kann es dazu kommen, dass ein eigentlich akzeptiertes und sogar gewünschtes Unterstützungsangebot allein infolge unannehmbarer Formulierungen nicht in Gang kommt oder abgebrochen wird
Intensität
Ambulante Einzelbetreuungen werden überwiegend mit einer wöchentlichen Stundenzahl von durchschnittlich fünf bis sieben Stunden pro Woche durchgeführt. Daraus ergeben sich etwa zwei Kontakte pro Woche. Zusätzlich finden Gespräche mit Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und bei Bedarf weiteren institutionellen oder informellen Netzwerkpartnerinnen und -partnern statt. Bei ländlicher Struktur kommen längere Fahrzeiten hinzu und je nach der Organisationsstruktur und dem Abrechnungsmodus des Trägers Teambesprechungen. Die eigentliche Kontaktzeit ist also im Durchschnitt relativ kurz und erlaubt rein zeitlich keine zu enge Beziehung. Die in diesem Rahmen umsetzbaren Kontrollmöglichkeiten sind gering, weil der weitaus umfangreichere Teil des Alltags selbst gestaltet bleibt. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist eine[43] intensivere Betreuung oft gar nicht umsetzbar, weil sie als Einschränkung der persönlichen Freiheit empfunden wird.
Zwischen dem zeitlichen Umfang der Kontakte und der Wirkung der Maßnahme besteht oft kein direkter Zusammenhang. Wichtig für die Wirkung scheint zu sein, dass die jungen Menschen die gemeinsam verbrachte Zeit schätzen und Anregungen durch die Hilfe für ihre persönliche Weiterentwicklung nutzen.
Читать дальше