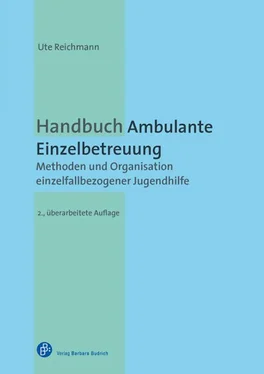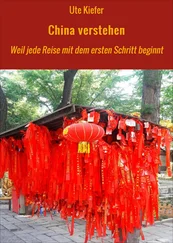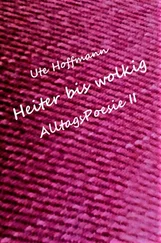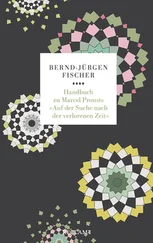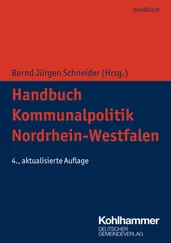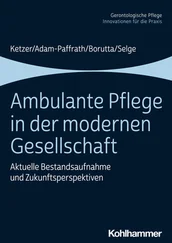Ute Reichmann - Handbuch Ambulante Einzelbetreuung
Здесь есть возможность читать онлайн «Ute Reichmann - Handbuch Ambulante Einzelbetreuung» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Handbuch Ambulante Einzelbetreuung
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Handbuch Ambulante Einzelbetreuung: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Handbuch Ambulante Einzelbetreuung»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Handbuch Ambulante Einzelbetreuung — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Handbuch Ambulante Einzelbetreuung», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Unabhängig vom Zugang und der Ausgangsproblematik werden die Hilfeangebote des Jugendamts durch das Verfahren der Hilfeplanung gesteuert, das alle Betroffenen, auch die jungen Menschen, an der Beratung, der Festlegung der Hilfe und der Interventionsplanung beteiligen soll. In der Praxis der Beratungs- und Erstgespräche tragen in der Regel die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialdienstes des Jugendamtes (ASD) zusammen mit den jungen Menschen und ihren Eltern die vorläufigen Ziele und Aufgaben für die zukünftige Jugendhilfemaßnahme zusammen.
In den Gesprächsprotokollen der oben genannten drei Fälle wurde unter der Überschrift „Was braucht der junge Mensch (notwendige Veränderungen)? Welche Ziele sollen mit der Hilfe erreicht werden?“ unter anderem Folgendes protokolliert:
„Christian und Dennis brauchen Stabilität und Konsequenz in der Erziehungshaltung. Es soll ein regelmäßiger Schulbesuch erreicht werden. Voraussetzung dazu ist die Erarbeitung einer Alltagsstruktur und ein Wiedererlangen des normalen Tag- Nacht- Rhythmus. Der ambulante Einzelbetreuer sollte den Zwillingen sinnvolle Möglichkeiten der Freizeitgestaltung vorstellen und sie ermutigen, sich sportlich zu betätigen, Kontakte zu knüpfen und sich ggf. in einem Verein zu engagieren.“
„Julia braucht eine ruhige und verlässliche Kommunikationspartnerin, der sie sich anvertrauen kann und an deren Seite sie mittelfristig lernt, sich zu öffnen und auf andere zuzugehen. Zunächst sollte die Einzelbetreuung hauptsächlich im Eins- zu- eins- Kontakt stattfinden. Da Julia in der Schule in ihren Leistungen zurückgefallen ist, sollte die Begleitung der Hausaufgaben mit zu den Aufgaben der Einzelbetreuerin gehören. Julia möchte gerne reiten lernen und wünscht sich, dass die Einzelbetreuerin ihr hilft, einen Verein zu finden, und sie anfänglich dorthin begleitet.“
„Rina soll vor allen Dingen an Gewicht zunehmen und in der Schule wieder Anschluss gewinnen. Die Einzelbetreuerin soll mit ihr eine gesunde Ernährung erarbeiten und mit ihr darauf achten, dass sie sie umsetzt. Die Jugendhilfemaßnahme soll darüber hinaus Rinas Eltern bei der Gesundheitsfürsorge unterstützen, nach Bedarf Rina zum Arzt begleiten und den Eltern vermitteln, was für Rinas Entwicklung und Förderung notwendig ist. Eine ständige Gewichtskontrolle Rinas ist erforderlich. Zu diesem Zweck soll engmaschig mit ihrer Ärztin kooperiert werden. Rina braucht Zuhause die Möglichkeit sich zurück zu ziehen und zum Beispiel in Ruhe ihre Hausaufgaben zu machen. Hierfür sollte die ambulante Einzelbetreuerin in Kooperation mit der Familie die Bedingungen schaffen.“
Auffällig an diesen Protokolltexten ist, dass sie einen starken Erwartungsgestus und zahlreiche Soll-Formulierungen in Bezug auf den jungen Menschen zeigen. Dessen Perspektive scheint gegenüber den Perspektiven der anderen Akteure nachgeordnet zu sein.
Es kommt leider nicht selten vor, dass in Hilfeplanprotokollen, Aufträgen und Zielformulierungen der ambulanten Einzelbetreuung und anderer Jugendhilfeangebote die betreuten jungen Menschen nicht als Subjekte betrachtet und angesprochen, sondern mit Forderungen der Eltern, Anpassungswünschen des Bildungssystems und gesellschaftlichen Ansprüchen auf Normerfüllung konfrontiert werden, hinter denen ihre eigenen [47]Vorstellungen, Planungen und Ziele unformuliert bleiben. Weder im Protokolltext zu den Zwillingen noch in dem zu Rina wird die Perspektive der jungen Menschen berücksichtigt. Auch wenn in Rinas Text anscheinend ihre Interessen formuliert werden, wird doch nur der gesellschaftliche Standard eines eigenen für die Anfertigung von Hausaufgaben angemessen ausgestatteten Zimmers mit ihren Bedürfnissen gleich gesetzt. Nur im Text, der sich auf die kleine Julia bezieht, kommen deren Wünsche als eigenständiger Auftrag an die Einzelbetreuung vor.
Wird die ambulante Einzelbetreuung zum Agenten der Interessen und Aufträge anderer Personen und Institutionen, kann dies die Möglichkeit verstellen, Ansatzpunkte, Motivation und Ziele beim jungen Menschen und seiner Perspektive zu finden. Einzelbetreuerinnen und Einzelbetreuer werden zum reinen Transporteur der Anforderungen Dritter an ein als passiv aufgefasstes Erziehungsobjekt.
Dies ist dann besonders heikel, wenn die Problemursache gar nicht beim jungen Menschen liegt. Nach den empirischen Daten der Kinder- und Jugendhilfestatistik werden nur etwa bei einem Drittel aller Jugendhilfemaßnahmen und bei weniger als der Hälfte der ambulanten Einzelbetreuungen die Gründe für die Beantragung der Hilfe in den Problemen des jungen Menschen gesehen. Dies können Verhaltensauffälligkeiten, eine von der Norm abweichende Entwicklung, schulische Schwierigkeiten oder Probleme bei der Ausbildung sein. Bei den übrigen zwei Dritteln aller Jugendhilfemaßnahmen und mehr als der Hälfte aller Einzelbetreuungen kommen elternbezogene Defizite als Hilfeanlass in Betracht: Junge Menschen werden durch die konfliktbeladene häusliche Situation, durch die Sucht der Eltern oder deren psychische Erkrankung, durch Erziehungsdefizite oder durch den Ausfall von Bezugspersonen infolge von Krankheit, Tod oder unbegleitete Einreise in ihrer Entwicklung beeinträchtigt und sogar gefährdet. 23Während bei den kindbezogenen Hilfeanlässen familienunterstützende Maßnahmen sinnvoll sind, wirkt Jugendhilfe bei den elternbezogenen Hilfeanlässen hauptsächlich familienergänzend: in Ersatzfunktion für eine ausgefallene oder disfunktionale elterliche Sozialisation und Erziehung. Trotzdem setzt – anders als bei der sozialpädagogischen Familienhilfe, bei der alle Beteiligten in ihrer Eigenverantwortung angesprochen werden – die ambulante Einzelbetreuung nicht auf eine direkte Einflussnahme bei den Eltern, sondern versucht eine elternunabhängige Förderung und Unterstützung des jungen Menschen unter Erhalt der familiären Strukturen. Den jungen Menschen wird die hauptsächliche Veränderungsverantwortung angelastet, ohne dass sie als Subjekte der Hilfe angemessen positioniert würden.
Neben diesem Widerspruch zwischen Veränderungsverantwortung und mangelndem Subjektstatus ist die methodische Position der ambulanten Einzelbetreuung auch deshalb unbefriedigend, weil die Problemursachen, die bei den Eltern liegen, im Konzept der Hilfe nicht ausreichend bedacht sind. Während die sozialpädagogische Familienhilfe sich methodisch eindeutig im systemischen Denken verorten konnte, alle Akteure zur Mitarbeit verpflichtet und eine vermittelnde, überparteiliche Einstellung einnimmt, bleibt die ambulante Einzelbetreuung auf den jungen Menschen fixiert.
Wenn der Veränderungsimpuls und die alleinige Verantwortung zur Problemlösung beim jungen Menschen angesiedelt ist, beinhaltet dies eine grundsätzliche Überforderung und kann als ungünstigen Nebeneffekt bewirken, dass Eltern vorschnell aus ihrer Verantwortung für die Problemlösung entlassen werden. Veränderung ist aber häufig nur als Entwicklung der ganzen Familie denkbar. Dies gilt besonders für Kinder, aber auch für [48]Jugendliche und sogar für junge Erwachsene, die meist auf ihre Herkunftsfamilien bezogen bleiben, selbst wenn der Kontakt nur selten stattfindet.
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz gesteht Kindern und Jugendlichen eine aktive Rolle im Prozess der Hilfeplanung zu. Doch dies wird bisher nicht umfassend umgesetzt (vgl. Pluto 2007). Die übergeordnete Aufgabe der ambulanten Einzelbetreuung wie jeder Jugendhilfemaßnahme besteht in der Ermöglichung von Partizipation und gesellschaftlicher Teilhabe des jungen Menschen. Dies bedeutet:
■ Die Einzelbetreuerin und der Einzelbetreuer sind angehalten die Partizipation des betreuten jungen Menschen in der Hilfeplanung so weitgehend wie möglich zu unterstützen (§ 8 und § 36 SGB VIII). Dies geschieht, indem die dazu notwendigen sozialen und Kommunikationskompetenzen angeeignet, die Reflexion, Formulierung und angemessene Durchsetzung der eigenen Interessen geübt, gemeinsam Planungs-, Verhandlungs- und Lösungsstrategien in der Auseinandersetzung mit anderen praktiziert werden und der Umgang mit Behörden und Institutionen trainiert wird. Die Jugendhilfemaßnahme und der sie begleitende Hilfeplanungsprozess ist selbst ein wesentliches Übungsfeld für die Haltungen und Kompetenzen, die gesellschaftliche Teilhabe und die Übernahme einer aktiven und verantwortungsvollen Rolle im Gemeinwesen ermöglichen. Dies kann nicht in Form von Anordnungen geschehen, sondern der Hilfeplanungs- und Hilfegestaltungsprozess als solcher muss von den Fachkräften so entworfen und umgesetzt werden, dass dem jungen Menschen die Vorteile eines kooperativen und demokratischen Verhaltens überzeugend erscheinen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Handbuch Ambulante Einzelbetreuung»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Handbuch Ambulante Einzelbetreuung» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Handbuch Ambulante Einzelbetreuung» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.