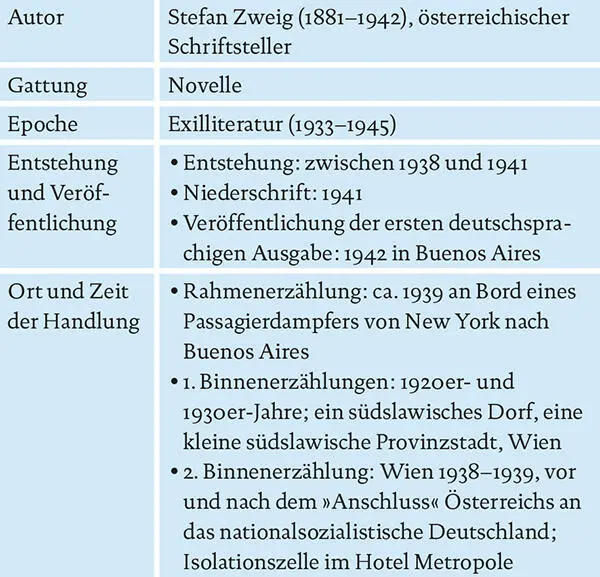Mirko Czentovic.Wie Dr. B. ist auch der Schachwunderkind Weltmeister eine ungewöhnliche Erscheinung, nur sind die ausgefallenen Wesenszüge seiner Figur anders gelagert. Czentovic tritt gleich zu Beginn der Novelle auf: Zusammen mit einem Bekannten verfolgt der Erzähler, wie er an Bord geht. Für beide ist der Schachprofi kein unbeschriebenes Blatt – in einer Rückblende wird der sensationelle Aufstieg des Waisenknaben zur internationalen Schachkoryphäe nachvollzogen. Die außerordentliche Begabung des Wunderkindes ist dabei gleichermaßen Gegenstand der Anekdote wie die Tatsache, dass er ein »völliger Outsider der geistigen Welt« (S. 11) bleibt. Deutlich erinnert die Episode, in der der 15-jährige den lokalen Schachgrößen im Dorfcafé eine Lektion erteilt (S. 9), an die Geschichte des kleinen Jesus unter den Schriftgelehrten, der diesen trotz seiner Jugend in Verständnis und Glauben voraus zu sein scheint. Inwieweit solche Informationen über Czentovic, die sich aus zusammengelesenen Pressemeldungen ergeben (S. 5 f.), von Wert sind, ist zu bezweifeln, zumal an anderer Stelle erwähnt wird, dass sich Czentovic gegenüber Reportern als wenig auskunftsfreudig erweist (S. 12).
Der Schachweltmeister ist eine paradoxe, zwiespältige Gestalt. Das Können, dem er seine Karriere verdankt, ist sehr Einseitiges Talent einseitig gelagert, sein Spiel phantasielos und unkreativ, allein auf sturer Logik beruhend. Die Auseinandersetzung mit dem Gegner ist für ihn wie eine Schlacht, in der Zähigkeit mehr gilt als Genialität – nicht ohne Grund wird er mit den Kriegern Kutusow und Fabius Cunctator verglichen, die auf diese Art die größten Feldherren ihrer Zeit, Napoleon und Hannibal, niedergerungen haben (S. 11). Die Welt von Czentovic besteht im Wesentlichen aus den 64 Feldern des Schachbrettes, ist »auf die enge Einbahn zwischen Schwarz und Weiß reduziert« (S. 16). Konsequenterweise wird auch nicht mitgeteilt, ob und was sich der Weltmeister zu den politischen Umbrüchen seiner Zeit denkt – er erscheint als durch und durch Phantasielos, zäh, unpolitisch unpolitischer Mensch.
Zwar bemüht sich Czentovic, den gepflegten Mann von Welt abzugeben, doch das Resultat ist kläglich: Im Grunde bleibt er immer der »beschränkte Bauernjunge« (S. 12) von früher, ein Primitivling, dem etwas Groteskes und Komisches anhaftet. Die Apathie, die Stumpfsinnigkeit und die Kontaktarmut seiner Jugend haben im Erwachsenenalter nur andere Formen angenommen, haben Czentovic zu einer leidenschaftslosen, Unsympathische Charakterzüge unzugänglichen Schachmaschine werden lassen.
Zwei Faktoren prägen das Verhältnis des Schachweltmeisters zum Schachspiel: Geld und Macht Geld und Macht. Nicht die Schönheit und die Eleganz von Kombinationen reizen Czentovic, sondern es reizt ihn die Gelegenheit, mit seinem Können Geld zu machen. Zugleich bietet ihm das Schachspiel die Möglichkeit, dem Rest der Welt seine Überlegenheit zu demonstrieren. Dieser Wille zur Macht lässt bei Czentovic unangenehme Charakterzüge zutage treten. Mit seinem psychologisch kalkulierten Verzögerungsspiel während der letzten Partie agiert er zugleich aggressiv und unsportlich. Er will damit Dr. B. aus der Fassung bringen, übt Druck auf ihn aus – vergleichbar dem Psychoterror, den der Anwalt während seiner Isolation hat erdulden müssen. Für das Seelenleben anderer hat der monomanisch auf das Schachbrett fixierte Czentovic wenig Verständnis: Den Zusammenbruch seines Gegners bei der letzten Partie quittiert er mit Selbstgefälligkeit und mitleidlosem Hohn.
Gewollte Kontraste Angenommen, Czentovic wäre ein sympathischer und leutseliger Herr, so wie Dr. B. gebildet und von guten Manieren, ein Gentleman, der seinen Gegner zwar auf dem Brett besiegt, dennoch aber Menschlichkeit und Sportsgeist ausstrahlt – wo bliebe die Dramatik der Novelle, wo ihr eigentlicher Reiz und wo ihre Kernaussage?
So wie die schwarzen und die weißen Figuren, die schwarzen und die weißen Felder des Schachbretts extreme Konflikt durch Gegensätze Gegensätze repräsentieren, so ist auch der ganze Text um Spannungen gebaut, um unvereinbare Charaktere und um schroffe Gegensätze. Ein Weltmeister von innerem Adel, der seinem Gegner Mut zuspricht, wäre da fehl am Platze. Denn die Novelle bewegt sich nicht auf Harmonie und Ausgleich zu, sondern zeigt einen Kampf bis aufs Messer, bis zu einem Punkt, an dem der eine Kontrahent psychisch aus dem Lot zu geraten droht. So ist es klar, dass sich bei den beiden Gegenspielern alles um Kontraste gruppieren muss:
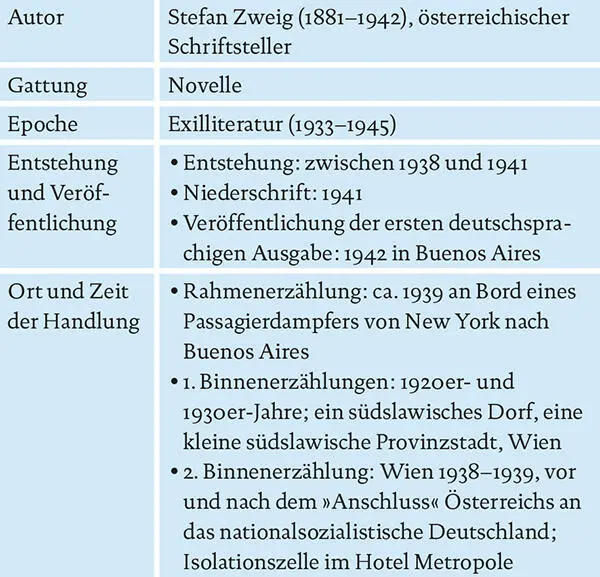
Weitere Figuren: McConnor und der Erzähler
McConnor.Für den schottischen Tiefbauingenieur McConnor ist US-Millionär Geld offensichtlich nur bedrucktes Papier. Er hat sein Vermögen in den USA mit Öl gemacht, wird also den Vorstellungen von der überdimensionalen amerikanischen Kaufkraft voll gerecht, die schon vor dem Ersten Weltkrieg in der deutschen Literatur thematisiert worden ist – beispielsweise in den Romanen Königliche Hoheit (1909) von Thomas Mann oder Die andere Seite (1909) von Alfred Kubin.
McConnor ist von massiger Gestalt, sein kräftiger Körperbau – besonders seine breiten Schultern (S. 18, 21) – signalisieren Entschlossenheit. Er gibt den tüchtigen Erfolgsmensch Erfolgsmenschen ab, für den es selbstverständlich ist, all das zu bekommen, was er will. Als Siegertyp verträgt er es nicht, zu verlieren. Sein ungesunder Ehrgeiz drängt ihn dazu, auf Niederlagen mit immer neuen Herausforderungen zu reagieren; dabei fehlt ihm die richtige Selbsteinschätzung, wie hundsmiserabel er wirklich Schach spielt.
Wie bei Vergleich mit Czentovic Czentovic überwiegen bei McConnor die wenig gewinnenden Charakterzüge, in gewissen Eigenheiten sind sie einander sogar ziemlich ähnlich. Beide sind – jeder auf seine Art – Geschäftsleute, denn für den Weltmeister bedeutet das Schachspiel die ausschließliche Geldquelle. Beide sind auf ihre eigene Person fixiert und zeichnen sich dabei durch eine Selbstsicherheit aus, die schon zur Selbstgefälligkeit und Unhöflichkeit wird.
Seiner Enttäuschung über Dr. B.s Enttäuschung über Dr. B.s Niederlage Niederlage macht sich McConnor recht unsensibel mit der Bemerkung »[d]amned fool« (S. 77) Luft. Dem ›Selfmademan‹ aus Schottland bleibt eine tiefere Einsicht in die Psyche des Exilösterreichers verwehrt. Ihm entgeht, dass die Partie für Dr. B. weit mehr ist als ein bloßer Schlagabtausch zweier Schachspieler, nämlich ein Kampf gegen sich selbst, dem er unterliegt.
Der Erzähler.Aktivität Für Stefan Zweig war die Ich-Form ein gern gewählter Weg, um eine Geschichte zu vermitteln. So auch in der Schachnovelle : Der namenlose Ich-Erzähler ist dabei selbst Teil dessen, worüber er berichtet; er beobachtet und hört zu; er betätigt sich listenreich, indem er zuerst seine Frau, dann McConnor als Lockvogel für Czentovic einsetzt; er arrangiert Begegnungen zwischen den Figuren und vermittelt zwischen ihnen; er greift aktiv in die letzte Partie ein und rettet damit seinen Landsmann.
Dem Wertende Ich-Perspektive Erzähler kommt auch bei der Verteilung von Sympathien und Antipathien eine wichtige Rolle zu, weil der Leser gleichsam durch dessen Augen die anderen Figuren wahrnimmt. Trotzdem ist der Charakter des Erzählers weniger ausgeprägt konturiert als jener von Dr. B., Czentovic oder McConnor. Gewiss schimmert die Person des Verfassers durch: Ihm gleich zeigt der Erzähler kultiviertes Benehmen, eine wache Neugier an der Psychologie seiner Mitmenschen und unternimmt die Schiffsreise in Gesellschaft seiner Frau – auf diese Art hatte auch Erzähler und Autor Stefan Zweig 1940 Europa verlassen. Den Erzähler deswegen auch Zweigs Emigrantenschicksal teilen zu lassen, ihn sogar mit dem Autor gleichsetzen zu wollen, scheint ein etwas voreiliger Befund zu sein,2 zumal über den Zweck seiner Reise ebenso wenig gesagt wird wie über seine gesellschaftliche Stellung oder über seinen Beruf.
Читать дальше