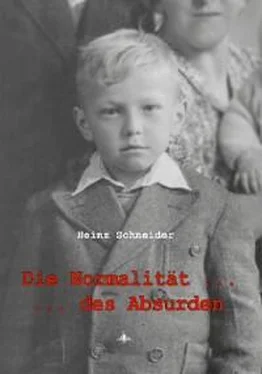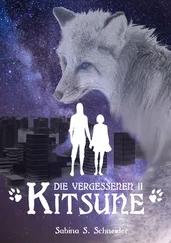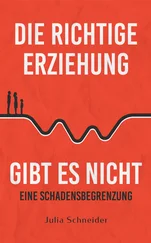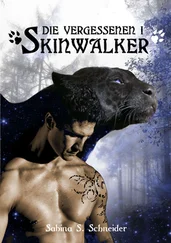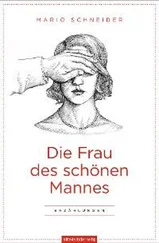Mein Spruch lautete: „Die Zeit braucht Deine Hände, halte Dich nicht fern.“ Dabei handelte es sich um ein Zitat des Berliner Arbeiterdichters Walter Dehmel (1903-1960). Nach der Feier, die ca. 90 Minuten dauerte, war die Festlichkeit zu Ende.
Wahl zum FDJ-Sekretär
Es war vermutlich im Sommer 1950, als ich von den Mitgliedern der FDJ nach der Funktionsaufgabe meiner Vorgängerin Ellen Schwenke mit vielen Gegenstimmen, aber der Stimmenmehrheit der Anwesenden in freier Wahl zum FDJ-Sekretär der Zentralen Oberschulgruppe gewählt wurde. Ich wurde erst auf der Versammlung – zu meiner eigenen großen Überraschung – als Kandidat nominiert und war mit Sicherheit nicht der Wunschkandidat der SED. Die anderen Kandidaten hatten noch mehr Gegenstimmen als ich, sodass ich – quasi in Form einer Kampfabstimmung – völlig demokratisch in die Funktion des FDJ-Sekretärs gelangt war.
Als solcher gehörte es zu meinen Pflichten, auch am Abitur des Jahrgangs 1951, der nur elf Schüler umfasste, teilzunehmen und eine gesellschaftspolitische Beurteilung für jeden Abiturienten zu erstellen. Mein Deutsch- und Lateinlehrer, Hermann Harras, bot sich an, diese für mich, der die Schüler der zwölften Klasse kaum kannte, zu verfassen. Als damaliger Klassenlehrer des Abiturientenjahrgangs fertigte er die gesamten Einschätzungen persönlich an, ich brauchte sie nur noch zu unterschreiben. So konnte er gewährleisten, dass jeder Abgänger seiner Klasse eine gute gesellschaftspolitische Beurteilung erhielt und aus dieser Sicht keine Schwierigkeiten bei der Aufnahme des Studiums bekommen würde. Gerne war ich auf sein Angebot eingegangen, von dem niemand etwas erfahren durfte und erfuhr.
Von den Mitgliedern der FDJ-Kreisleitung in Ludwigslust wurde ich permanent bedrängt, Oberschüler für den Dienst in der bewaffneten Streitmacht der DDR zu gewinnen, die sich damals noch „Deutsche Volkspolizei“ nannte. Es gelang mir jedoch nicht, auch nur einen einzigen Schulkollegen für den Dienst in der „Volkspolizei“ zu werben. Um selbst aber in den Augen der Schulkameraden nicht unglaubhaft dazustehen, blieb mir der eigene Eintritt in die bewaffneten Kräfte der DDR nicht erspart. Ähnlich erging es damals auch anderen FDJ-Sekretären.
Mitglieder der SED gab es in der Dömitzer Oberschule damals nicht. Rudi Koszorek, der in der SED-Kreisleitung Ludwigslust tätig war, hatte mich mit Fritz Henning zum Anhören einer stundenlangen Radiosendung – der Debatte des Deutschen Bundestages – in seine Wohnung in die Dömitzer Walther-Rathenau-Straße eingeladen. Dr. Konrad Adenauer hielt eine lange eindrucksvolle Rede. Offenbar wollte Rudi Koszorek als „Weichensteller“ meine politischen Ansichten und den Grad meines „Klassenbewusstseins“ erkunden. Ich hörte mir die Sendung an und sagte – nichts.
Sicher war ich für die Genossen der SED eher eine arge Enttäuschung. Das geht auch daraus hervor, dass ich – obwohl frei gewählt – auf Drängen höherer Stellen möglicherweise sogar abgesetzt werden sollte, was mir erst jetzt aus einer Broschüre von Dr. Karl-Heinz Ebel (Schwerin) über die Nachkriegszeit in Dömitz bekannt wurde. Denn er als ein früherer, zu Unrecht abgelöster Vorgänger in meiner Funktion wurde von einem mir nicht bekannten Vertreter des damaligen Landesvorstands in der Zeit meiner Wahlperiode gebeten, die Geschäfte der FDJ-Oberschulgruppe doch wieder zu übernehmen, um deren Moral zu stärken und „die Karre aus dem Dreck zu ziehen“. Mir selbst sind damals allerdings keine Anzeichen irgendwelcher Unzufriedenheit des Kreis- oder Landesvorstands an meiner Leitung aufgefallen oder mitgeteilt worden. Im Gegenteil: Ich erhielt sogar die „Friedensmedaille der FDJ“, eine relativ hohe Auszeichnung, und eine Buchprämie vom Ludwigsluster Kreisvorsitzenden der FDJ. Die Kampagne gegen die „Junge Gemeinde“, deren Mitglieder als „Kugelkreuzler“ bezeichnet wurden, begann erst nach meinem Ausscheiden aus der Funktion des FDJ-Vorsitzenden der Zentralen Oberschulgruppe. Mit ihr hatte ich nichts zu tun.
Nach meinem achtzehnten Geburtstag befand ich mich in der elften Klasse und nur noch ein halbes Jahr in der Dömitzer Oberschule. Man hat mich damals wohl bedrängt, zur „Polizei“ zu gehen. Ich kann mich aber beim besten Willen nicht daran erinnern, dass irgendjemand versuchte, mich für die SED zu werben. Nachdem Vater ebenfalls der Ansicht war, dass es gut wäre, wenn ich als Sohn eines Arbeiters zur „Volkspolizei“ ginge, habe ich mich schließlich dazu – ohne jede Begeisterung – entschlossen. Am Sonnabend, dem 5. Juli 1952, war mein letzter Schultag in der elften Klasse. Ich wurde in die zwölfte Klasse versetzt und ergriff laut Abschlusszeugnis den „Beruf eines Volkspolizisten“.
Die ersten Wochen bei der Volkspolizei
Zwei Tage später trug ich die damals noch dunkelblaue Uniform der Volkspolizei, kam nach Schwerin in die Dienststelle Stern-Buchholz. Schon nach wenigen Tagen sah ich innerhalb dieser Einheit einige DDR-Panzer vom Typ T-34 und schnell wurde mir klar, dass es sich gar nicht um eine Polizeiformation, sondern um eine neue, im Aufbau befindliche Armee handelte, die zudem offensichtlich schon seit einigen Jahren als „Hauptverwaltung für Ausbildung“ bestanden hatte.
Ich verpflichtete mich zunächst für drei Jahre, mein erster Dienstgrad war „VP-Anwärter“. Ich lernte zu schießen, zu marschieren, den Schrank in Ordnung zu halten, und erfüllte auch die sonstigen militärischen Übungen zur vollen Zufriedenheit meiner Vorgesetzten. Im Politunterricht erfuhren wir viel vom „Klassenfeind“, der jenseits der Demarkationslinie die Deutsche Demokratische Republik ständig bedroht. Diese Propaganda wiederholte sich in stets monotoner Weise, war allen hinreichend seit Jahren bekannt und wirkte bald ausgesprochen langweilig. Manche Kameraden schliefen beim Politunterricht regelmäßig ein. Zudem war der Intelligenzgrad mancher Politoffiziere damals erstaunlich niedrig, sodass man es als ehemaliger Oberschüler schwer hatte, diese stundenlange „Belehrung“ im Sinne einer typischen Schwarz-Weiß-Malerei bei voller Konzentration über sich ergehen zu lassen.
Als Verbündete der ruhmreichen Sowjetunion galten auch wir stets als die Sieger der Geschichte, während aus der Sicht der DDR der Westen in Form der Bundesrepublik nur die Politik der verbrecherischen Nazis fortführte und alle positiven Veränderungen im Osten Deutschlands, wie die Bodenreform, die demokratische Schulreform, die Enteignung der Kapitalisten usw., rückgängig machen wollte. Aber wir als die legitimen Vertreter der deutschen Arbeiterklasse würden dem Machtstreben unserer Klassenfeinde schon einen Riegel vorschieben und unsere Republik wirkungsvoll – gemeinsam mit der Sowjetunion – schützen und im Bedarfsfall mit der Waffe in der Hand verteidigen. Denn niemandem sollte es erlaubt werden, das Rad der Geschichte jemals zurückzudrehen. Dafür würden wir schon sorgen.
Ich war damals der Meinung, dass wir in der DDR eine Armee brauchten, und betrachtete die Republik als die einzige nur denkbare positive Nachkriegsalternative für unser geschundenes Land. Natürlich bemühte ich mich um gute militärische Leistungen. In meinem Inneren aber war ich, von unseren verantwortungsvollen, hochintelligenten Dömitzer Lehrern, wie Dr. Schimke und Hermann Harras, dazu erzogen, eher ein Pazifist. Das aber behielt ich geflissentlich für mich. Es war auch sicher besser so.
In Korea tobte ein schrecklicher Krieg und die dortige Volksarmee befand sich auf dem Rückzug, nachdem die USA in dieses Gemetzel eingegriffen und die Nordkoreaner aus dem fast vollständig eroberten Süden der Halbinsel wieder zurückgedrängt hatte. Auch die sogenannten chinesischen „Volksfreiwilligen“ konnten einen Sieg der bereits geschwächten Nordkoreaner nicht herbeiführen, sodass der Krieg am 27.7.1953 mit einem Waffenstillstand am 38. Breitengrad ungefähr dort endete, wo er begonnen hatte. Die Kommunisten hatten eine schwere Niederlage erlitten. Gott sei Dank blieb dem geteilten Nachkriegsdeutschland, vermutlich aufgrund der Erfahrungen aus Korea, ein ähnlich hartes Schicksal erspart.
Читать дальше