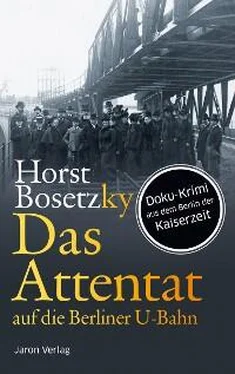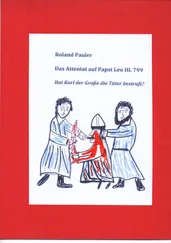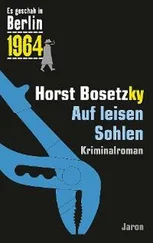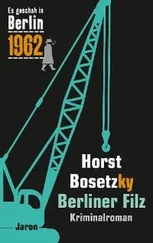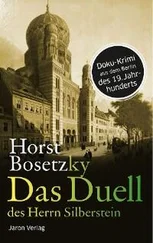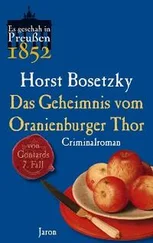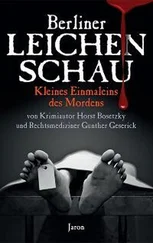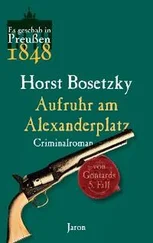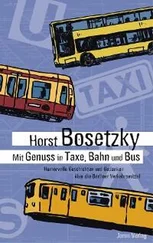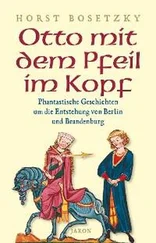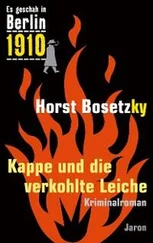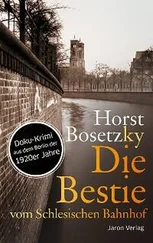Endlich kam Minna vom Einkauf zurück, stellte ihren Korb auf den Bürgersteig und sah zu Hermann herauf.
»Wat is nu?«
»Sofort!«
Schnell fuhr er seinen Galgen mit den Rollen aus und ließ das Seil herab. Der Haken schlug punktgenau vor Minnas Beinen auf das Pflaster, und sie hatte keine Mühe, den Henkel ihres bis an den Rand gefüllten Weidenkorbs an ihm zu befestigen.
Sie hob die rechte Hand. »Et kann losjehn! Hau ruck!«
Hermann Mahlgast begann, an seinem Ende des Seils zu ziehen, und hatte wenig Mühe, den Korb nach oben schweben zu lassen. Etliche Passanten stoppten ab, blieben stehen und klatschten Beifall. Das gefiel ihm, ohne dass er so eitel gewesen wäre, sich zu verbeugen.
Schon war der Korb zum Greifen nahe, und er beugte sich vor, um ihn zwischen zwei Blumenkästen hindurch auf den Balkon zu ziehen – da geschah das Malheur. Der Haken, den er in die Dachlatte gedreht hatte, wurde durch das immense Gewicht aus dem Holz gerissen. Der Korb gehorchte den Gesetzen der Schwerkraft und raste wie ein Meteor unaufhaltsam auf das Dienstmädchen zu. Die konnte gerade noch zur Seite springen, als er neben ihr aufs Pflaster schlug, ja geradezu explodierte. Schreie hallten durch die Belle-Alliance-Straße.
Alles hätte noch unter den Teppich gekehrt werden können, wenn nicht gerade in diesem Augenblick eine Droschke vor dem Wohnhaus gehalten und in dieser Droschke seine Mutter gesessen hätte. Der war das Ganze furchtbar peinlich, denn sie fürchtete nichts mehr, als zum Gespött der anderen zu werden.
»Eine Woche Stubenarrest!«, rief sie, als sie den Tatbestand eruiert hatte.
»Bitte, nein, Mutter, ich bin mit Ludolf verabredet – wir wollen nach Lichterfelde raus, die erste Straßenbahn der Welt sehen.«
»Zwei Wochen Stubenarrest!«
Ludolf Tschello wusste sehr wohl, dass er ohne das Zeugnis der Reife keinen Zugang zur Universität erhielt, aber er hatte sich geschworen, zum Erreichen dieses Ziels nicht mehr zu tun, als unbedingt nötig war. Non scolae, sed vitae discimus. So ein Unsinn. Wozu musste er, der Ingenieur werden wollte, wissen, wie das zu übersetzen war. Natürlich lernte er nicht für das Leben, sondern für die Schule. Hausarbeiten vergaß er grundsätzlich. Schludrig war er zudem, nie waren seine Schulbücher sauber eingeschlagen, nie schrieb er einen Text ohne diverse Tintenkleckse. Dass er dennoch nie sitzenblieb, lag daran, dass ihm alles zuflog. Und was ihm nicht zuflog, das hasste er. Die Lehrer verhöhnte er als furchtbar medioker, und dennoch schafften sie es nicht, ihn scheitern zu lassen, denn der Rektor seines Gymnasiums hielt ihn für ein Genie. Das mochte auch daran liegen, dass dieser der Musik leidenschaftlich verbunden war, das Geigenspiel über alles schätzte und Ernst Moritz Tschello, den Vater Ludolfs, seinen Freund nannte und immer wieder zu privaten Empfängen einlud.
Ludolf Tschello war schlank und dunkelhaarig und ließ alle Frauen, saß er am Klavier und spielte Chopin, dahinschmelzen. Zwar war er kein so begnadeter Virtuose wie sein Vater, aber bei sachgemäßer Ausbildung am Konservatorium hätte er es in die berühmtesten Orchester bringen können, doch er wollte nichts anderes werden als Ingenieur. Musik verklingt , hatte er einmal in einem Aufsatz geschrieben, aber die Pyramiden stehen ewig .
Seine Eltern sah er wenig. Der Vater hatte andauernd Proben und Konzerte, die Mutter war damit beschäftigt, Gutes zu tun, und kümmerte sich lieber um Trinker, liederliche Dirnen und kinderreiche Frauen, denen der Mann davongelaufen war. So musste Ludolf sich selber erziehen, was ihm durchaus recht war.
Langeweile hatte er nie. Entweder stromerte er durch die Stadt und heftete sich an die Fersen schöner Frauen und Mädchen, oder er saß zu Hause in seinem Zimmer, spielte Klavier oder entwarf kühne technische Bauwerke, so etwa riesige Türme aus Stahlträgern oder eine hängende elektrische Bahn, deren Rollen auf dicken Stahlseilen liefen, die hoch über der Spree aufgehängt waren. Von Charlottenburg bis Oberschöneweide sollte sie gehen.
Am 16. Mai 1881 fuhr in Lichterfelde, das damals noch nicht zu Berlin gehörte, die erste öffentlich betriebene elektrische Straßenbahn im Linienverkehr. Die Strecke zwischen dem Bahnhof an der Anhalter Bahn und der Hauptkadettenanstalt an der Finckensteinallee hatte eine Länge von etwa 2,5 Kilometern. Die Spurweite betrug einen Meter, und der Strom wurde den Motoren über die beiden Fahrschienen zugeführt. 180 Volt Spannung waren es. Der behördlichen Anordnung gemäß sollte die durchschnittliche Geschwindigkeit fünfzehn Stundenkilometer betragen und durfte an keiner Stelle zwanzig Kilometer pro Stunde übersteigen. Zwanzig Personen fasste der Wagen.
»Vata, wo is ’n det Pferd?«, fragte ein Junge, der staunend stehen geblieben war.
»Das befindet sich sozusagen unter dem Wagenkasten.«
»Isset überfahrn worn?«
»Nein, das nennt man jetzt Motor. So ein Elektromotor ist viel stärker als ein richtiges Pferd.«
Der Wagenführer, der zugleich auch Schaffner war, achtete darauf, dass die Säbel und Degen der Offiziere ausgehakt waren, weil man ansonsten damit rechnen musste, dass die Garderoben der Damen Schaden nahmen. Sollte es losgehen, rüttelte er am Seil einer Glocke, die am Führerstand auf der offenen Plattform über ihm hing. Nachdem er gebimmelt hatte, drehte er an der Kurbel des Fahrschalters, und die Bahn setzte sich langsam in Bewegung.
Noch einmal wurde kräftig gebimmelt, denn wieder einmal spielten Kinder mitten auf den Schienen. Auch manch Erwachsener unterschätzte die Geschwindigkeit des Gefährts.
Ein gerade vorüberzuckelnder Droschkenkutscher schüttelte den Kopf. »Bevor das gefährliche Ding sich breitmacht, muss der alte Zentralfriedhof wieder in Betrieb genommen werden – wegen der Verkehrsopfer.«
Ein wenig abseits unter einer alten Eiche stand Werner Siemens und verfolgte das Treiben um seine Straßenbahn mit gemischten Gefühlen.
Erich Abendroth, der ihn auch an diesem Tage nach Lichterfelde begleitet hatte, sah ihn prüfend an. »Es scheint mir, als könnten Sie sich über den Erfolg Ihrer Straßenbahn gar nicht so recht freuen.«
»Wie denn auch?«, fragte Werner Siemens. »Zwar wird man nun nicht mehr anzweifeln können, dass sich der elektrische Bahnbetrieb bestens für die Praxis eignet, aber dies hier ist nicht mein Traum, das ist doch nur eine von ihren Säulen und Längsträgern auf den Erdboden verlegte Hochbahn – und die ist das Eigentliche, um das es mir geht.« Und mit der Schuhspitze zeichnete er in den Sand, wie er sich die Sache vorstellte.
Diese Zeichnung versetze Hermann Mahlgast und Ludolf Tschello anfangs in helles Entzücken, als sie, kaum dass Siemens und sein Ingenieur weitergegangen waren, den Platz unter der Eiche besetzten.
»Das ist ja alles nur eingleisig«, sagte Ludolf Tschello, von der simplen Konstruktion doch ein wenig enttäuscht.
»Zwei Längsträger mit ihren Säulen nebeneinander wären zu teuer«, meinte Hermann Mahlgast. »Man kann ja auch Ausweichen bauen.«
Ludolf Tschello blieb weiter sehr kritisch. »Und nur ein einziger Wagen oben auf den Schienen, da passen doch viel zu wenige Menschen rein. Wenn ich da an die Stadtbahnzüge denke, wie lang die sind.«
»So ein kleiner Elektromotor hat nun mal nicht so viel Kraft wie eine große Dampfmaschine auf Rädern«, belehrte ihn der Freund.
»Dann muss man stärkere Elektromotoren bauen«, forderte Ludolf Tschello.
Hermann Mahlgast lachte. »Dann sag das doch mal dem Herrn Siemens, da steht er ja noch.«
Das traute sich Ludolf Tschello dann doch nicht, aber vielleicht hätte er es getan, wenn sich in diesem Augenblick nicht ein Stückchen weiter ein Riesengeschrei erhoben hätte. Was war geschehen? Ein Droschkengaul hatte mit einem seiner vorderen und einem seiner hinteren Beine die verschieden gepolten Straßenbahnschienen so unglücklich berührt, dass der Strom durch seinen Körper floss. Da war er dann durchgegangen, und der Droschkenkutscher hatte das Tier erst hundert Meter weiter wieder bändigen können. Aber nicht er tobte, sondern sein Fahrgast.
Читать дальше